
„Sag mir, was du fühlst!“ – der Fotograf
Auch wenn es die hartgesottene Splatter-Fraktion anders sehen mag: Horrorfilme müssen nicht alles zeigen. Die größte Wirkung erzeugt meist die Suggestion, das imaginierte Grauen im Kopf der betrachtenden Person. Der Genre-Trend des neuen Jahrtausends weist jedoch in eine Richtung, die im Sinne der Überbietungslogik grafischer Gewalt Grenzen des Zeigbaren auslotet. So hat etwa das „Saw“-Franchise maßgeblich dazu beigetragen, die Maßstäbe für zumutbares Blutvergießen im kommerziellen Kino neu zu definieren. Doch Torture Porn der Maßgabe „Saw“ ist nichts im Vergleich zu dem, was abseits des Mainstreams auf die Zuschauenden lauert.
Ein Beispiel mit geradewegs notorischem Ruf ist „Murder-Set-Pieces“ (Alternativschreibweise: „Murder Set Pieces“), den Nick Palumbo anno 2004 für stolze zwei Millionen US-Dollar fertigte. Nach eigenem Bekunden ist es der teuerste komplett unabhängig produzierte Horrorfilm aller Zeiten. Das war es aber auch fast schon an rühmlichen Informationen. Denn im Bestreben, Tabus zu brechen, schien Palumbo nahezu jedes Mittel recht. Das führte u. a. dazu, dass ihn drei Kopierwerke (einschließlich der renommierten Technicolor) abblitzen ließen und die Suche nach einem Cutter zur schieren Odyssee geriet. Schlussendlich erklärte sich allein Todd C. Ramsay, der etwa die John-Carpenter-Klassiker „Die Klapperschlange“ (1981) und „The Thing – Das Ding aus einer anderen Welt“ (1982) editiert hatte, bereit, das sadistische Szenenpotpourri in Form zu schneiden.
Den Streifen als Füllhorn des Kontroversen zu umschreiben, ist wahrlich keine Übertreibung. Das belegt gleich der Auftakt, der einem Jack the Ripper zugeordneten, unzweifelhaft gegen Juden gerichteten Zitat Bilder des von Rauchwolken umwehten New York während der Anschläge vom 11. September 2001 folgen lässt. Und das ist erst der Anfang eines Films, der vor keiner Provokation zurückschreckt. Wie fragwürdig (und obendrein peinlich) diese bisweilen erscheinen, zeigt sich an der strohdummen Titeleinblendung „In Association with Third Reich Ventures“, der im Abspann durch die Nennung von „Herman Goering“, „Heinrich Himmler“ und „Joseph Goebbels“ als Produzenten die Krone aufgesetzt wird.
„Pictures never lie.“ – der Fotograf
Die visuelle Ambition dieser auf 35mm-Film gebannten Geschmacklosigkeit lässt die Distanz zu Pseudo-Snuff-Schockern der Gangart „August Underground“ (2001) durchaus üppig erscheinen. Im Gegensatz zur Handlung. Die rankt sich um einen namenlosen Fotografen deutscher Abstammung (Sven Garrett, „Dances With Werewolves“), der in Las Vegas reihenweise Frauen ablichtet – und abschlachtet. Woher der Hass auf die vornehmlich blonden Frolleins rührt, veranschaulichen Rückblenden in die Kindheit des Serienkillers, die Wahlweise Mama auf Bahngleisen oder eine gefesselte Puppe in der Kinderstube einbringen. Daneben serviert Palumbo einige Zwischenszenen, in denen der gestählte Teutone auf der Hantelbank Gewichte stemmt. Dazu läuft im Hintergrund auch mal eine Rede Adolf Hitlers. Ohne Nazi-Hintergrund wäre es ja nur halb so anstößig.
Antisemit, Mörder, Frauenfeind. Was fehlt noch? Vergewaltiger, Kannibale und Nekrophiler etwa. Wir sind schließlich in einem Film, der nichts auslässt. Außer Tiere. Immerhin. Was Palumbo aber in 90 Minuten verwurstet (die unfertige originale Kinofassung dauerte 105 Minuten, entsprach aber nicht der Vision des C-Auteurs), kann den Selbstzweck zu keiner Zeit verleugnen. Anders als etwa „Henry – Portrait Of a Serial Killer“ (1986) geht es hier nicht um das nüchterne Psychogramm eines Mörders, sondern die effektreiche Zurschaustellung seines blutigen Treibens. Und blutig ist „Murder-Set-Pieces“ fürwahr. Dass Palumbo bis zum Schlussdrittel manchen Akt im Off geschehen lässt, ändert nichts an der immensen Brutalität des Gezeigten.
In seinem blutbesudelten Folterkeller quält, missbraucht und zerstückelt der Fotograf seine Opfer. Mal treibt er Nägel durch gefesselte Glieder, mal setzt er die Kettensäge direkt am Kopf an. Die Effekte von Toe Tag Pictures, den Machern der „August Underground“-Reihe – deren Regisseur Fred Vogel tritt in einer Mini-Rolle als maskierter Räuber selbst in Erscheinung – sind alles andere als zimperlich. Trotz der übergeordneten Verrohung erweist sich der Splatter-Marathon mit seinen mehr als zwei Dutzend Opfern als ziemlich ermüdend. Vorrangig, da Palumbo die wiederkehrenden Einzelteile in ihrer Verkettung kaum variiert. Sicher, der Film ist so heftig wie die Hasstiraden des Killers dürftig sind, doch erweist sich das Gezeigte als dermaßen „drüber“, dass die anvisierte verstörende Schockwirkung weitgehend ausbleibt.
„I am the bastard son of a goddamn whore.“ – der Fotograf
Der erzählerische Rahmen ist das, was der Titel reflektiert. Oder: Oberkörper stählen, Nacktheit ablichten, Leiber schinden. Verdacht schöpft einzig Jade (Jade Risser), die Teenager-Schwester einer der Freundinnen des Deutschen. Wer könnte es ihr verdenken, wo dem bekennenden Führer-Fanboy der Wahnsinn (und die Frauenfeindlichkeit) doch aus jeder Pore strömt? Nur die verliebte Charlotte (Valerie Baber, „Emmanuelle vs. Dracula“) rückt von der Anhimmelung ihres gestählten Teutonen-Romeos nicht ab. Zur Polizei geht Jade indes nicht. Dabei sollte es für diese ein Leichtes sein, dem Massenmörder auf die Schliche zu kommen. Schließlich zeigt der nie Mühe, seine blutigen Spuren zu verwischen und wirft gar einen abgetrennten Kopf aus seinem Auto, nachdem er sich damit befriedigt hat.
Zwischen Slasher-Routine, Folter-Porno und kalkulierter Grenzverschiebung sind es zwei Szenen, die maßgeblich zum berüchtigten Status des Streifens beitrugen: Die Ermordung eines Mädchens auf einer Spielplatz-Toilette und die Einbindung eines Kleinkindes nach der Tötung einer Frau. Selbst die seitens der Macher bestätigte Anwesenheit der Mutter am Set macht diese Sequenz, die darin mündet, dass sich der etwa zweijährige Junge schreiend an die Leiche seiner (Film-)Erzeugerin klammert, nicht weniger verwerflich – denn dem buchstäblichen Jungdarsteller ist die Panik durchweg ins Gesicht gemeißelt. Selbst Werke wie dieses sollten irgendwo eine Grenze ziehen. Bei oben genannten Momenten ist diese fraglos überschritten.
Die kurzen, insgesamt wenig gehaltvollen Auftritte von Tony Todd („Candyman“), Gunnar Hansen (dem Leatherface aus dem originalen „Texas Chainsaw Massacre“), Edwin Neal (dem Anhalter aus „Texas Chainsaw Massacre“) und Cerina Vincent („Cabin Fever“) dienen allein Marketing-Zwecken. Doch auch sie können die Abstinenz jeglicher Substanz nicht kaschieren. Das erwartungsgemäß nicht zwingend überzeugende Schauspiel samt gnadenlos chargierendem Hauptpart ist da noch das geringste Übel. Wenn es eines noch positiv zu erwähnen gilt, dann ist es der als Hommage an Dario Argento gereichte Goblin-Gedächtnis-Soundtrack (vom US-Duo Zombi) beim Flanieren durch Las Vegas. Ansonsten bleibt Palumbos bis dato letztes Werk eher aus Kuriositätsgründen im Gedächtnis haften. Und natürlich ob der überharten Gewaltdarstellung. Was es daraus zu lernen gilt? Vielleicht, zwischendurch auch mal die Beine zu trainieren. Oder besser noch: das Hirn.
Wertung: 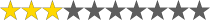 (3 / 10)
(3 / 10)
