
Pseudo-Snuff und die Geschichte vom gläubigen Charlie
Wenn man den berüchtigten Beiträgen zum Splatterfilm eines zugutehalten kann, dann ist es die Aushebelung der Konformität. Moderner Horror mag bisweilen Unbehagen bereiten, doch haftet ihm eine Berechenbarkeit an, die im kommerziellen Kontext einer gewissen Komfortzone gleicht. Ein bisschen Grusel ist erbeten, nachhaltiges Verstören eher nicht. Wem das zu wenig ist, findet weit abseits des Mainstreams Filme, die mehr Bewährungsprobe denn Unterhaltungsvehikel markieren.
Einer der am heftigsten diskutierten Beiträge des neuen Jahrtausends ist der Pseudo-Snuff-Schocker „August Underground“ (2001) – und mehr noch dessen erste Fortsetzung „August Underground’s Mordum“ (2003) –, der die Betrachtenden mit Handkamerabildern konfrontiert, die in Sachen Sadismus schwer zu überbieten sind. Die Besonderheit liegt dabei im Kalkül, größtmöglichen Realismus vorzugaukeln. Das kann man angesichts des Snuff-Themas ruhigen Gewissens verwerflich finden, doch stehen derartige, (buchstäblich) explizit an ein Nischenpublikum gerichtete Grenzerfahrungen für die urtümliche Unberechenbarkeit des Horrors. Sich ihr auszuliefern, verlangt bisweilen starke Nerven. Oder Mägen.
Ein Werk, das „August Underground“ & Co. unzweifelhaft als Wegbereiter dient, ist „Flowers of Flesh and Blood“. Der zweite Teil der japanischen „Guinea Pig“-Reihe, die zwischen 1985 und 1988 sechs eigenständige Filme (und einen 1991 nachgeschobenen Zusammenschnitt mit Szenen sämtlicher Beiträge) hervorbrachte, gilt als eine Blaupause des Torture Porn. Zur Popularitätssteigerung des kaum eine Dreiviertelstunde dauernden Streifens soll maßgeblich beigetragen haben, dass US-Schauspieler Charlie Sheen (genau, die Koksnase mit Tigerblut!) nach der Sichtung einiger Szenen glaubte, eine echte Straftat gesehen zu haben und zu deren Meldung das FBI kontaktierte.
Ob Sheen dabei unter dem Einfluss berauschender Substanzen stand, lässt sich bestenfalls mutmaßen. Doch weist „Flowers of Flesh and Blood“ verschiedene Merkmale auf, die seine gestellte Machart mehr als nur erahnen lassen. Zur Ehrenrettung des „Two and a Half Men“-Stars sei aber fairerweise angemerkt, dass der Pseudo-Snuff von Manga-Zeichner Hideshi Hino (inszenierte auch den „Guinea Pig“-Eintrag „Mermaid in a Manhole“, 1988) tricktechnisch auch nach heutigen Standards erschreckend hochwertig umgesetzt ist. Selbst wenn ein Wort wie „hochwertig“ im vorliegenden Kontext durchaus verzerrend anmutet.
Die Inszenierung als Fake-Wegweiser
Eines steht unmissverständlich fest: „Flowers of Flesh and Blood“ polarisiert. Zwangsläufig. Trotzdem soll an dieser Stelle eine möglichst distanzierte Betrachtung erfolgen – auch wenn der Versuch, bei einem künstlerischen Extrem wie diesem Objektivität anzusetzen, noch unmöglicher erscheint als in den meisten Rezensionsfällen. Das beginnt bei den einleitenden (und beschließenden) Texttafeln, mit denen Autor und Regisseur Hino einen scheinbar realen Hintergrund strickt, der auf an ihn adressierte „Fan-Post“ verweist, die einen 8mm-Snuff-Clip, diverse Fotografien und einen umfänglichen Brief enthielt. Auf dieser Grundlage entschloss sich der Zeichner dazu, den schändlichen Film in semi-dokumentarischer Manier nachzustellen.
Auf eine Handlung im eigentlichen Sinne wird dabei verzichtet. Der Anfang zeigt Menschen auf den Straßen Tokios. Für Handkamerabilder wirken diese trotz ihrer Reduktion inszeniert, was durch den professionellen Schnitt unterstrichen wird. Hinos angeblicher Nachstellung verschafft das Möglichkeiten, die über heute gängige Found-Footage-Formeln hinausreichen. Das zeigt sich auch bei späteren Szenen, von denen im Vorgriff drei erwähnt werden sollen:
- Wenn das ans Bett gefesselte weibliche Opfer den Kopf hebt, um zu ergründen, woher das schleifende Geräusch stammt, fährt die Kamera an ihrem Körper entlang, ohne dass die Frau diese beachten würde.
- Wenn der Mörder das Betäubungsmittel anrührt, erfolgt ein abrupter Zoom in sein Gesicht.
- Bevor der Frau das Narkotikum verabreicht wird, steht eine Einblendung der Spritze in einer totalen vor unscharfem Hintergrund.
Auch Charlie Sheen dürfte solche Kniffe als typische Stilmittel der Filmindustrie erkannt haben. Ganz abgesehen davon, dass der von Hiroshi Tamura verkörperte Killer mit schlechtem Gebiss und Samurai-Aufzug fortwährend sein Gesicht in die Kamera hält. Vielleicht wurde Sheens Eindruck allein von den knüppelharten Gewaltakten geprägt. Oder vom Umstand, dass der Mörder die Zuschauenden unmittelbar adressiert und die von ihm verübten Gräuel mit erblühenden Blüten – nur eben aus Fleisch und Blut – vergleicht.
Gemeinsam mit seinem Kameramann (in einer Szene ist auf dem Bettlaken zudem der Schatten der Mikrofon-Angel sichtbar, was die Riege der Beteiligten weiter erhöht) verfolgt und verschleppt der Snuff-Samurai eine junge Frau (Kirara Yûgao), um sie in einem Kellerraum mit reichlich blutbesudelten Wänden zu zerstückeln. Die Bewegungen des Killers wirken mitunter sehr theatralisch und angestrengt künstlich – fast so, als wähne er sich in einem Stummfilm. Dazu passt auch, dass er vor jedem neuen „Eingriff“ ankündigt, aus welchen Körperteilen der Frau er als nächstes „Blüten“ sprießen lässt.
Ein zwiespältiges Bouqet blutiger Blumen
Nach dezent gedehnter Herleitung, in der die Bestie mit den Zähnen und der Verkleidung aus dem feudalen Japan die Messer schleift und vor den Augen des Opfers ein Huhn köpft (die Szene kommt übrigens ohne Tier-Snuff aus!), folgen rund 20 Minuten purer Splatter-Exzess. Nach der Betäubung, die der bedauernswerten Frau nicht vollends die Sinne rauben soll, zerlegt er ihren Körper. Mit einem Springmesser schneidet der Schlächter ihr die Hände ab. Der Realismus der Effekte verblüfft. Vor allem, wenn er eine Hand durch die Befestigung an der Sehne abreißt, worauf sich die Finger um seine eigenen krallen.
Schonungslos geht es auch beim Abtrennen der Arme am Schultergelenk zu. Hammer und Meißel inklusive. Dass sich das Opfer bis zuletzt regt, erscheint angesichts des immensen Blutverlusts reichlich überzogen. Aber auch das ist Teil dieser Zirkusvorstellung, bei dem die zersägte Frau am Ende nicht unversehrt von der Bühne winkt. Nachdem die Beine der Frau entfernt wurden, werden ihre Eingeweide freigelegt und auf dem geöffneten Körper drapiert; quasi das Grabgesteck des eingefleischten Kellersadisten. Wem das noch nicht genügt, darf (oder muss) in der Folge erleben, wie der Torso enthauptet wird. Und als wenn das der sinnlosen Brutalität nicht bereits die Krone aufgesetzt hätte, löffelt der Psychopath noch ein Auge aus dem Kopf und lutscht daran herum.
Die Frage nach dem „Braucht man das?“ wird bei Filmen wie „Flowers of Flesh and Blood“ gern gestellt. Nur verfehlt sie den Kern der Sache. Denn eine/r sagt ja, der/die nächste nein. Hinos extremer Aderlass ist sehr gut gemachte Gewalt-Perversion. Nicht mehr, nicht weniger. Als ein Inbegriff des Splatters zeugt er von der Befriedigung der Neugier auf das Innere der/des anderen – und veranschaulicht zugleich überdeutlich den Stumpfsinn dieser Prämisse. So lebt der berüchtigte Schocker bis heute von seinem „Dare to Stare“-Ansatz. Die Substanz ist ihr bewusster Mangel. Das muss man aus der Perspektive des Künstlers respektieren. Gutheißen hingegen muss man es keineswegs.
Gegen Ende, vor dem Blick auf die morbide „Kollektion“ des Metzgers, sitzt der Samurai in der angerichteten Schweinerei und raucht eine Zigarette. Das Klischee der Kippe danach ist eine bewusste Übersteigerung. Nur ist der Film keine Satire, sondern Gewalt-Voyeurismus für die ganz hartgesottene Klientel. Und die wird zweifelsfrei nur selten noch deftiger bedient als hier. Von Komfortzone kann da wahrlich keine Rede sein. Von einem „hochwertigen“ Filmerlebnis allerdings ebenso wenig.
Wertung: 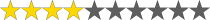 (4 / 10)
(4 / 10)
