
„Welcome to the present, where the love generation reigns supreme, their ideals of peace and love mostly forgotten in a sea of cell phones and ipods. Pleasantly distracted from the horrors of our world, we carry on in ignorance.
Late in 2006, the President of the United States was assassinated by a religious extremist. The country carried on with life as usual. The American way… but in a quaint costal fishing town a small group of Satan worshipping family people saw his passing as a sign.“
In der Regel ermöglichen solch einleitende Textzeilen in Filmen eine kontextuelle Einordnung, ohne diese inszenatorisch darstellen zu müssen. Das spart Zeit und nicht zuletzt Budget. „The Gateway Meat“ ist anders. In vielerlei Hinsicht. Denn vorangestellt gibt es eine eröffnende Warnung: „This film contains graphic violence, gore, self mutilation, adult language, drug and alcohol use, nudity, prolonged graphic sex sequences and strong themes of religious and political satire.“ So, so, eine Satire also. Auf dem (digitalen) Papier mag das reizvoll erscheinen. Nur ist der von Ron DeCaro („Emancipation“) als Regisseur, Autor, Cutter, Hauptdarsteller sowie Co-Kamera- und Effekt-Verantwortlicher gefertigte Streifen dem Amateursegment zuzuordnen. Als wenn der offensive Umgang mit Sex und Gewalt die Zielgruppe nicht schon genug eingrenzen würde…
Ein Mangel an Ambition kann DeCaro nicht zum Vorwurf gemacht werden. Allerdings fehlt es am Vermögen, die entartete Vision eindrücklich Realität werden zu lassen. Das offenbart bereits der Auftakt, bei dem die digitale Handkamera Schmetterlinge in einem sonnendurchfluteten Küstengarten einfängt. Im Off sprechen Vater und Tochter über den Tod des Großvaters. Was unscheinbar und nicht zuletzt zusammenhanglos erscheint, verweist auf eine Familiengeschichte, die mit Blut geschrieben ist. Schrittweise erschlossen wird sie über die Off-Erläuterungen von Markus (DeCaro). Der zieht mit Gattin Lizzy (Turibia Fradoca) und Töchterchen Sophia (Sophia Flynn) ins Domizil des Erzeugers und versucht in dessen Fußstapfen als satanisches Machtzentrum zu treten.
In den wirren, gern steif aufgesagten Dialogen lassen sich auch Andeutungen darüber ausmachen, dass im Keller ein Portal zur Hölle geöffnet werden soll. Warum aber gerade die vollgedröhnten Freizeit-Sadisten um den ewig hadernden Markus dazu imstande sein sollte, bleibt durchweg fraglich. Jedenfalls braucht es für die Verbindung der Welten Opfer. Damit an denen kein Mangel besteht, schweift der Blick auf Markus‘ Vertrauten Roland (D. Whitney), der sich gern mit Drogen vollpumpt und die verwesende Leiche einer schwangeren Frau als „Fuck puppet“ hegt. Der ausgemachte Psychopath hat sichtlich Spaß am Traktat zufällig aufgegriffener Mitmenschen.
Das sorgt für bemüht verstörende Bilder, die durch die teils gelungenen handgemachten Effekte (erinnerungswürdig bleibt vorrangig der „Colombian Necktie“) getragen werden. Allerdings erreichen diese nur ansatzweise die realitätsnahe Wirkweise eines Fred Vogel („August Underground“), der die Produktion als „Special Voiceover Guest“ unterstützte. Formal bleibt „The Gateway Meat“ im Rahmen der Möglichkeiten solide, in schnellen Blenden und teils abrupten Schnitten aber mitunter auch dezent ungelenk. Zum Kontrastreichtum des Gesamtwerks trägt auch das „kunstvolle“ Moment bei, das durch Bildverfremdungen oder den Einsatz klassischer Musik Ausdruck erhält, dabei aber partout nicht zu den mitunter haarsträubend agierenden Laiendarstellern (man beachte den überzogen Fluchtiraden absondernden Drogendealer) passen will.
Überhaupt kann DeCaro die Anmutung einer willkürlich verknüpften, oft zäh überdehnten Szenensammlung nur schwerlich entkräften. Da hilft wenig, dass die Zahl unbequemer Momente über Vergewaltigung, Folter und Mord in Hälfte zwei zunimmt. Wenn dies unausgereifte Motiv-Potpourri wirklich satirisch angelegt sein soll, geht die Überzeichnung in der unzureichenden Ausführung komplett unter. So verpufft selbst der grimmige Schlusspunkt, bei dem der kleinen Sophia eine befremdliche Bedeutung zufällt. Der Gore-fixierten Klientel mag das genügen. Der Rest kann froh sein, dass der Streifen kaum 70 Minuten Lebenszeit in Beschlag nimmt.
Wertung: 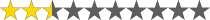 (2,5 / 10)
(2,5 / 10)
