
Der Unterschied zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung ist bisweilen gewaltig. Ein exemplarisches Beispiel findet sich im experimentellen Horror-Schocker „The Bunny Game“, den Adam Rehmeier („Dinner in America“) anno 2010 mit überschaubaren Mitteln und noch überschaubarerem Konzept drehte. Der Film entstand ohne Drehbuch, auf Basis einer Story-Skizze, die Rehmeier mit Hauptdarstellerin und Co-Produzentin Rodleen Getric ersann. Dabei ließ die Schauspiel-Debütantin eigene schmerzliche Erfahrungen einfließen; im ergänzend gedrehten Bonusmaterial der physischen Veröffentlichung gibt sie an, selbst mehrfach verschleppt worden zu sein.
Darüber hinaus erfolgten die Dreharbeiten ohne begleitende Crew. Rehmeier übernahm nahezu sämtliche Produktionsaufgaben, von der Kameraführung über den Schnitt bis hin zum Soundtrack. Für die Beteiligten ist der Streifen eine Grenzerfahrung. Mit Ausnahme von Drogen- und Alkoholkonsum soll alles Gezeigte echt sein: der anfängliche Blow Job, die Gewalt, die psychische Folter. Verpackt wird das Ganze in einen Ansatz, den Rehmeier und Getric unbedingt als Kunst verstanden wissen wollen. Kunst mit reinigender Wirkung. Doch die Katharsis des/der einen ist des/der anderen Geduldsprobe. Denn die anvisierten Kontroversen erweisen sich bei näherer Betrachtung als relative Luftnummern.
Zunächst schildert Rehmeier den Alltag einer jungen, lediglich als „Bunny“ gelisteten Prostituierten (Getric). Neben verlorenem Treiben durch die anonyme Großstadt ist ihr Sein von Sex, Drogen und Misshandlung geprägt. Die angestrengten Schwarz-Weiß-Bilder, hektische Schnitte und die direkte Kameraführung erinnern nicht selten an die Underground-Ästhetik von Musik-Videos. Als Bunny von einem Freier betäubt, vergewaltigt und ausgeraubt wird, gewinnt die Abwärtsspirale zusätzlich an Fahrt. Dass es jedoch noch schlimmer geht, muss sie erfahren, als sie in den Truck des bärtigen Hog (Jeff F. Renfro, als Transporteur u. a. an „Leben und Sterben in L.A.“ beteiligt) steigt.
Auch er betäubt Bunny, kettet sie im Laderaum seines Boliden fest und setzt sie über fünf Tage psychischer und physischer Folter aus. Mehr Handlung gestatten Rehmeier und Getric ihrem Werk nicht. Auch gesprochen wird wenig. Nur gestöhnt, geschrien und gefleht. Die in rasanten Schnittfolgen mit vereinzelten Erinnerungsfragmenten angereicherten Bilder sollen schockieren. Nur schaffen sie keine Brücke zwischen Publikum und Hauptfigur. Da helfen auch keine echten Tränen. Überhaupt nutzt sich der Ansatz von „The Bunny Game“ schnell ab. Für die Arthouse-Fraktion durch Provokation ohne Substanz, für Gorehounds durch die Abstinenz entgrenzter Gewalt.
Zwar werden Bunny Videoaufnahmen vom Schicksal einer anderen Geisel (Drettie Page) vorgeführt, der Einsatz von Kunstblut bleibt jedoch konsequent ausgespart. Fraglos haftet der Aura des Streifens etwas Abscheuliches an. Allerdings resultiert dies allein aus der Entmenschlichung des Individuums. So wird das Opfer kahl geschoren, mit Hasenmaske durch die Einöde getrieben und mit einem (echten) Branding versehen. Dazwischen schleift Hog, der auch mal mit Schweinsmaske auftritt, sein Messer oder zieht sich eine Plastiktüte über den Kopf. Das in seiner düsteren Andeutung durchaus gelungene Finale ist einer der wenigen positiven Aspekte. Ihm steht auch der unpassende Death-Metal-Soundtrack gegenüber. Und der Umstand, dass sich Bunny in ihrem Gefängnis nie erleichtern muss. Aber das wäre der „inneren Reinigung“ vermutlich zu viel gewesen.
Wertung: 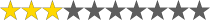 (3 / 10)
(3 / 10)
