
„I need to dismiss the spirit.“ – John
„So do I. Where’s the bathroom?“ – Mike
Es braucht eine zwingende Affinität zu B-Filmen, um Werke wie „Ghoulies“ wertschätzen zu können. Ein Grund: die im Vergleich zu Großproduktionen sichtbar schmaleren Möglichkeiten bei Set-Designs, Ausstattung und Tricks. Doch die Produktionsgüte ist längst nicht alles. Deutlich schwerer wiegt der Charme des Schundigen, der auch davon getragen wird, dass Budgets oftmals kaum ausreichen, um wirklich etwas passieren zu lassen. Aus dieser Not haben die Granden des abseitigen Kinos, solche wie Roger Corman („Death Race 2000“), eine Tugend gemacht. Auch Charles Band darf zur Garde eingefleischter B-Enthusiasten gezählt werden. In den fünf Jahrzehnten seines Wirkens hat er mehr als 290 Filme produziert und dabei u. a. die langlebige „Puppet Master“-Reihe auf den Weg gebracht.
In den mittleren 1980ern, seine Produktionsfirma Empire International Pictures war kaum gegründet, half Band bei der Realisierung eines Streifens, der ungeachtet seiner Qualität drei Fortsetzungen nach sich zog. Die Rede ist von „Ghoulies“, der gern als Rip-Off der weit erfolgreicheren „Gremlins“ (1984) verortet wird, in Wahrheit aber nahezu zeitgleich entstand. Zur Ehrenrettung trägt das allerdings kaum bei, entpuppt sich die von Luca Bercovici („Convict 762“) als Regisseur und Co-Autor verantwortete Grusel-Groteske doch als erzählerischer Flickenteppich mit inkonsistentem Amüsement-Faktor. Da hilft wenig, dass Randakteur und „MacGyver“-Widersacher Michael Des Barres eine wonnig überzogene Perfomance hinlegt. Als Satanist Malcolm Graves gedenkt er im Prolog, Baby-Söhnchen Jonathan zu opfern. Die grün leuchtenden Augen machen dabei weniger her als das schmissige Kellerset, an investiertem Herzblut lässt es der Auftakt jedoch nicht mangeln.
Das schändliche Ritual wird durch die Kindsmutter, ein magisches Amulett und den treuen Wolfgang („Erasherhead“ Jack Nance) unterbunden. Anstatt des Kindes muss die Erzeugerin sterben, was Malcolm aber auch nicht davor bewahrt, ein vorzeitiges Ende zu finden. Sprung in die Gegenwart: Der erwachsene Jonathan (Peter Liapis, „Undeclared War“) bezieht das väterliche Anwesen mit Freundin Rebecca (Lisa Pelikan, „Leon“). Der alte Wolfgang verdingt sich als Hausmeister des Grundstücks und darf obendrein überflüssige Off-Erläuterungen beisteuern. Bei der Erkundung des neuen Domizils wühlt sich Jonathan durch die okkulten Hinterlassenschaften Malcoms und beginnt bald selbst, der Schwarzmagie zu erliegen. Bei einem Versuchsritual beschwört er unbemerkt die Ghoulies, recht steif modellierte Knautsch-Monster, die allein er sehen kann.
Positiv erscheint, dass Bercovici seinen Film nicht sonderlich ernst nimmt. Das hilft zunächst darüber hinweg, dass der Plot schwerlich in Gang kommt und die von John Carl Buechler („From Beyond“) kreierten Ghoulies als zweifelsfreie Hauptattraktion zu selten – und in Summe kaum gewinnbringend – eingesetzt werden. Aber der Humor driftet, wie Jonathans Kiffer-Freund Mike (Scott Thomson, „Police Academy“) belegt, ohnehin bevorzugt gen Albernheit ab. Dazu passt auch, dass Jonathan beim Tritt in die familiären Fußstapfen zwei Kleinwüchsige in Rüstungen (Peter Risch und Tamara De Treaux) beschwört. Warum? Weil er es kann! Doch während eines Rituals, dass ihm unermessliche Macht bescheren soll, erweckt er den verstorbenen Vater von den Toten, der sogleich die Kontrolle über die Ghoulies ergreift und zumindest für einen zarten Horror-Hauch sorgt.
Immerhin die Kameraführung von Mac Ahlberg („House“) und der Score von Bands Bruder Richard („Re-Animator“) bewegen sich über B-Niveau. Der Rest entlockt kaum mehr als ein müdes Gähnen, wenn Jonathan per magischem Zutun die sich entfremdende Rebecca gefügig machen will oder ohne echten Zusammenhang zu abendlichen Gelagen mit Mike & Co. bittet. So ist am Ende aber wenigstens eine gewisse Opferschar garantiert, der die Ghoulies mit ein bisschen Blutbeigabe auf die Pelle rücken darf. Die Attribute „langsam“ und „ereignisarm“ lassen sich trotzdem nicht abschütteln, selbst wenn das finale Duell der Magier samt aus den Augen geschossener Energieblitze noch einmal das Zwerchfell erschüttert. Was bleibt ist ein denkbar simpler B-Streifen mit vereinzelten Schmalspurschocks und albernem Monsterterror. Wer hier Spaß haben möchte, sollte sich definitiv gewahr sein, was geboten wird. Und nicht. Ein echter Charles Band eben.
Wertung: 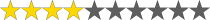 (4 / 10)
(4 / 10)
