
Es gibt Filmgattungen, bei denen man sich konstant fragen muss, warum jeder noch so qualitätslose Beitrag über den heimischen Bildschirm flimmern muss. Eine Lernkurve scheint weder bei den Machern noch beim eingefleischten Zielpublikum (der Verfasser ist sich der Ironie im Hinblick auf die eigene Person vollauf bewusst) erkennbar. Der Tier-Horror ist ein treffliches Beispiel. Die Fahne alter Glorie wird durch sporadische Kinoproduktionen aufrechterhalten. Konsequent torpediert wird sie jedoch durch ein Übermaß fürs Heim-Entertainment gefertigter Schnellschüsse, die den Standard-Themenkomplexen bestenfalls marginale Variation bescheren.
Eine schier unerschöpfliche Quelle ist der Bezahlsender Syfy, der in reger Folge spartanische Spartenunterhaltung mit mörderischem Getier auftischt. Ein selbst für die damit verknüpfte Messlatte unter Durchschnitt rangierender Beitrag ist „Surrounded“ (Originaltitel: „Frenzy“). Der klaubt seinen Ideenfundus bei Vorreitern wie „Open Water“ (2003), „The Shallows“ oder „47 Meters Down“ (beide 2016) zusammen, beschränkt sich dabei allerdings auf hysterisch überzogene Spannungs-Nebelkerzen und eine dümmliche Hai-Dämonisierung, die „Jaws“-Urvater Peter Benchley bis zur Pulverisierung im Grabe rotieren lassen müsste.
Der von Jose Montesinos („5-Headed Shark Attack“) ohne erkennbares Geschick gefertigte Survival-Thriller rankt sich um die schüchterne Lindsey (Aubrey Reynolds, „Sinister Minister“). Die begleitet ihre ältere Schwester Paige (Gina Vitori, „Tryst“), die zur Finanzierung ihrer internationalen Urlaubsabenteuer einen Reise-Vlog betreibt, nebst Freunden nach Südostasien. Dort soll ein verbotener Schnorchel-Trip in ein Naturschutzgebiet mit der Kamera dokumentiert werden. Auf dem Weg stürzt das gecharterte Wasserflugzeug jedoch über dem Ozean ab und zerbricht.
Wer hofft, mit dem binnen zwölf Tagen für weniger als 500.000 US-Dollar in Thailand gedrehten Schmalspur-Schocker adäquat unterhalten zu werden, dürfte seine Erwartung spätestens mit dem Crash des lachhaft schlichten CGI-Fliegers neu justieren. Denn der überschaubare Produktionsaufwand schlägt sich gnadenlos auf die Qualität nieder. Apropos gnadenlos: Kaum ist der Flieger bruchgelandet, tauchen drei angriffslustige weiße Haie auf. Während von Paige zunächst jede Spur fehlt, kann sich Lindsey auf ein Schlauchboot retten. Allerdings sorgen die in Formation (!) attackierenden Raubfische dafür, dass ihr und den übrigen Überlebenden die größten Schrecken noch bevorstehen.
Dabei versucht Montesinos, den Zuschauer über plumpe Herzschlag-Schockmomente zu ködern, die in ihrer reißerischen Aufmachung aber kaum mehr als reges Kopfschütteln hervorrufen. Obendrein wird es zunehmend lächerlich, wenn Lindsey wiederholt schneller schwimmt als das Hai-Trio oder bei Attacken bessere Reflexe offenbart. Überflüssige Rückblenden sollen dem dramaturgisch ungelenken Treiben mehr Tempo verleihen, dienen aber einzig dazu, Lindseys offenkundig wenig zukunftsfähige Beziehung mit Seb (Taylor Jorgensen, „Shadows of the Dead“) zu beleuchten. Also konzentriert sich die fadenscheinige Horror-Gurke auf die Haie, die immer nur dann in Erscheinung treten, wenn der vorhersehbar dämliche Plot auf Spannung zu pochen versucht.
Um Eintönigkeit vorzubeugen, verlagert sich das Geschehen zwischenzeitlich unter Wasser, ehe ein an einer Felsformation vertäutes Floß den Weg Richtung haltlos übertriebenem Showdown ebnet. Dabei wird der Plan, einen Hai mit einem verknoteten Felsbrocken zu erschlagen, in seiner cartoonesken Naivität allein von dessen Gelingen überflügelt. Ein bisschen Blut und Wunddetails sollen den Zuschauer bei der Urangst vor dem unberechenbaren Schrecken aus der Tiefe des menschlich nicht beherrschten Elementes packen. Bei dieser ganzheitlich gescheiterten TV-Unsäglichkeit vermag allerdings auch das nichts mehr zu retten.
Wertung: 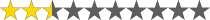 (2,5 / 10)
(2,5 / 10)
