
Endzeit ist einfach: Es braucht verlassene Industrieareale, Geröllwüstensettings und motorisierte Marodeure. Was es im Gegenzug nicht braucht, dahingehend gibt George Miller mit seinen „Mad Max“-Filmen seit jeher die Richtung vor, sind großspurige Dialoge. Da liegt die Krux von „Future World“, der neben Gewalt und grellen Typen auch betont tiefschürfenden Wortreichtum und religiöse Symbolik einbringt. Das Ergebnis ist vor allem eins: misslungen. Was Hollywood-Star James Franco („The Disaster Artist“) geritten hat, diese lachhafte Entschuldigung eines altschulischen Genrefilms als Darsteller und Co-Regisseur zu begleiten, kann wohl nur mit dem exzentrischem Hang begründet werden, sich in möglichst vielen kreativen Sujets unbändig auszutoben.
Bereits die viel zu lange Exposition macht deutlich, dass Franco und sein auch am Drehbuch beteiligter Regie-Kumpan Bruce Thierry Cheung („The Color of Time“) dem Zuschauer Sitzfleisch abverlangen. Bei einer Filmlänge von kaum 90 Minuten kommt das nicht weniger als einer Bankrotterklärung gleich. Die zum Ende der Zivilisation führende Vorgeschichte rumpelt über künstliche Intelligenz, Synthetik-Menschen und Bombenhagel der totalen Zerstörung entgegen. Ach ja, eine todbringende Epidemie gibt es auch. An der erkrankt in der Gegenwart die Mutter (findet faktisch nicht statt: Lucy Liu, „Elementary“) des jungen Prince (Jeffrey Wahlberg, „Don’t Come Back From the Moon“). Dass die beiden, entgegen des Trends, in einer heimeligen Oase hausen, bleibt für die Geschichte schlicht ohne Belang.
Um die Erzeugerin zu retten, macht sich Prince auf den beschwerlichen Weg, um ein Heilmittel zu organisieren. Wo er das aufstöbern kann, zeigt ihm, na klar, eine Postkarte mit Strandpanorama. Dass er am Meer tatsächlich fündig wird, unterstreicht die Einfalt eines Skripts, das vermutlich als Hommage an 70er- und 80er-Perlen wie „Mad Max“, „Straße der Verdammnis“ oder „Cherry 2000“ gedacht war. In der Realität führt das jedoch zu einem B-Film mit prominenter Besetzung – mit dabei sind auch Clifford „Method Man“ Smith („Red Tails“) und Bruce Willis‘ Tochter Rumer („Air Strike“) – sowie einer losen Verkettung absurd bestusster Szenen. James Franco, der in den Credits lediglich als „Warlord“ gelistet wird, ist Anführer einer brutalen Bande, die auf Motorrädern übers Land brettert und einen der letzten verbliebenen, nach Gutdünken steuerbaren Kunstmenschen sucht.
In Person der adretten Ash (ausdrucksarm: Suki Waterhouse, „Insurgent“) wird er fündig. Nur hat die High-Tech-Gespielin mit Kabelbaum unter der Bauchdecke keine Lust, zum Spielball eines dreckverkrusteten post-apokalyptischen Psychopathen zu verkommen. Ergo flieht sie bei einem Zwischenstopp in der neonbunten Strip-Bar des freakigen Love Lord (Snoop Dogg, „Hood of Horror“) mit Zufallsbekanntschaft Prince. Narrative Kohärenz sucht man bei „Future World“ vergebens. Eine zwingende Visualisierung ebenfalls. Ein paar gelungene Einstellungen hält der Film fraglos parat. Nur stehen ihnen durchs Bild schneidende Überblenden entgegen, die selbst in der „Star Wars“-Gründerzeit des Guten zu viel gewesen wären.
Schauspielerisch sticht, man glaubt es, oder nicht, „Resident Evil“-Heroine Milla Jovovich hervor, die sich als Königin der Rauschsubstanzen in maritimem Ödland zügelloser Übertreibung hingibt. Zu ihr gelangt Prince, als er die verwundete (oder besser: defekte) Ash in einem Tempo durch die Wüste schleppt, das dem Turbo-Killerfisch aus „Der weiße Hai IV“ glatt den Rang ablaufen könnte. Das Nachsehen haben der mit feschem Hörnerhelm versehene Warlord und seine Biker, die auf ihren Maschinen erst ins Drogenparadies gelangen, als der angepasst miese Showdown ruft. Davor gibt es noch eine homoerotische Eskapade zwischen Ash und Technikerin Lei (Margarida Levieva, „Allegiance“), ein bisschen Gewalt und zahllose Gründe, noch vor dem Abspann (bloß nicht die Post-Credit-Szene verpassen!) den Kopf durch den Bildschirm zu rammen. Das kann wahrlich nicht jeder Film von sich behaupten.
Wertung: 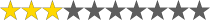 (3 / 10)
(3 / 10)
