 „Da ist irgendwas im Wasser und das ist bestimmt keine Meerjungfrau.“
„Da ist irgendwas im Wasser und das ist bestimmt keine Meerjungfrau.“
2000 war das Jahr der Monsterviechereien. Avi Lerners Billigfilm-Schmiede Nu Image investierte die Portokasse und ließ „Spiders“, „Crocodile“ und „Octopus“ am Fließband schauspielerische Nullnummern verputzen. Und weil das ganze immenses Vergnügen bereitete, folgte jedem Untier stehenden Fußes seine verdiente Fortsetzung. Andere Wirkungsstätten filmischer Wertschätzung durften da natürlich nicht zurückstehen und warfen ihrerseits monströses Getier auf den Videomarkt. „Blood Surf“ ist ein solcher Abklatsch vom Abklatsch und müht sich nach Leibeskräften, das Niveau der Konkurrenz noch unter Normalnull zu zerren.
Der titelgebende „Blood Surf“ – obwohl der Film im Original eigentlich „Krocodylus“ heißt – ist ein Extremsport der besonderen Art. Umringt von gefährlichen Haien frönen die todesmutigen Wellenreiter ihrer Begabung und versuchen die im Klischee gefräßigen Meeresräuber in der Brandung abzuschütteln. Als ein amerikanisches Team (u.a. Matt Borlenghi, „DinoCroc“) die wagemutigen Aktionen auf Film bannen will, taucht unvermittelt ein Riesenkrokodil auf und fordert sein verdientes Futterrecht ein. Was der nimmersatte Unhold in den Gewässern der Thailändischen Insel verloren hat, bleibt das Geheimnis der Drehbuchautoren – darunter „Ein ausgekochtes Schlitzohr“-Co-Schreiber Robert L. Levy. Doch fällt damit der Startschuss zum obligatorischen Rennen, Retten und Flüchten.
„Blood Surf“ ist haarsträubend schwachsinniger Unfug mit schlechten Darstellern, und preiswerten Effekten. Die vielseitigen und gänzlich hanebüchenen Plotwendungen halten neben einem verlassenen Eiland und militanten Piraten auch peinliche Softsex-Einlagen bereit. So darf einer der Surfer die Tochter des angemieteten Bootseigners bespringen, während deren Eltern vom garstigen Getier vertilgt werden. Dass die frisch deflorierte im Anschluss auch gleich mit verknuspert wird, interessiert kaum – nicht zuletzt, weil sich Surferboy so nicht mehr darum scheren muss, gerade eine Minderjährige begattet zu haben. Aber auch der toughe Kapitän, der sowieso noch ein Hühnchen mit der Bestie zu rupfen hat, macht seinem Mädel zwischendrin mal den Hengst von hinten. Das löst die Anspannung und hält beim Zuschauer zumindest ein Äuglein offen.
Wer den streckenweise anständig inszenierten Kroko-Trash über seine gesamte Lauflänge verfolgt, der wird immerhin mit einigen – gemessen an der 16er-Altersfreigabe – überraschend blutigen Fressattacken entschädigt. Am Durchschnitt kratzt der zitierfreudige Billig-Horror damit längst nicht. Jedoch animiert „Blood Surf“ immerhin zeitweilig zu erhöhter Aufmerksamkeit. Regisseur James D.R. Hickox („Kinder des Zorns 3 – Das Chicago Massaker“) ist der Sohn von Douglas Hickox („Theater des Grauens“, „Zulu Dawn“) und der Bruder von Anthony Hickox („Waxwork“, „Hellraiser III“). Bei der nicht unbedeutenden Vergangenheit seiner Anverwandten hätte er es eigentlich besser wissen sollen. Hat er aber nicht, weshalb er zwei Jahre später mit „Sabertooth – Angriff des Säbelzahntigers“ ein ähnlich stumpfsinniges Machwerk nachschob.
Wertung: 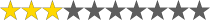 (3 / 10)
(3 / 10)
