
Über Jahrhunderte hinweg war das Duell ein festen Regeln unterworfenes Mittel, um nicht allein in erlauchten Kreisen ehrbezogene Streitigkeiten auszutragen. In der Neuzeit sind die potentiell tödlichen Zweikämpfe verboten. Mit „Blunt Force Trauma“ – hierzulande mit dem Vorrang „The Gunfighters“ versehen – etabliert Autor und Regisseur Ken Sanzel („Kill Chain“) eine Subkultur im kolumbianischen Hinterland, die das Duell als illegales Kräftemessen mit Handfeuerwaffen reanimiert. Die Opponenten tragen dabei schusssichere Westen, um die Gefahr für Leib und Leben zumindest anteilig zu reduzieren. Doch Kevlar hin oder her: Die abgefangenen Treffer hinterlassen Blessuren am Körper, denen der unabhängig produzierte Streifen seinen Originaltitel verdankt.
Für die in der Parallelwelt kleiner Duellveranstaltungen gestrandeten Existenzen zählt der Kick des Spiels mit dem eigenen Leben. Denn selbst wenn nur auf den geschützten Torso gezielt werden darf, bedeutet das nicht, dass alle Kugeln auch wirklich ihr Ziel finden. So fließt in schummrigen Hinterhöfen, Kellerräumen und Industrieanlagen mitunter tatsächlich Blut. Ziel ist es, das Gegenüber durch Treffer aus einem auf dem Boden markierten Kreis zu bugsieren. Irgendwann, irgendwo, begegnen sich bei einer solchen Veranstaltung John (Ryan Kwanten, „True Blood“) und Colt (Freida Pinto, „Slumdog Millionaire“). Er strebt nach Ruhm, sie nach Vergeltung. Allerdings haben die Duelle für ihn an Reiz verloren. Das Ziel seiner Reise ist die Konfrontation von Szene-Legende Zorringer (mit finalem Gastauftritt: Mickey Rourke, „The Wrestler“).
Für eine Weile reisen John und Colt zusammen. Daraus speist sich das balladesk anmutende, betont lakonische Road Movie. Die moderat aufregende Pistolen-Action steht nicht im Mittelpunkt, sie dient lediglich als Triebfeder der beiden Hauptfiguren. Die kommen sich auf ihrem Trip ins Ungewisse langsam näher, was Sanzels Vorstellung von Romantik in einem Privat-Duell auf die Spitze treibt. Kwanten und Pinto geben sich keine Blöße. Nur begnügt sich das Skript damit, ihnen gewollt tiefschürfende Dialoge in die Münder zu legen, die von getragener Gitarrenmusik unterstrichen werden. Das bedeutet nicht, der Film wäre vollends misslungen. Ähnlich „Donnybrook“ (2018) bleibt die Erzählung aber zu bedeutungsbefangen und vergeudet darüber einen Gutteil des vorhandenen Potentials – und der schauspielerischen Kompetenz.
Hinzu kommt das schleppende Tempo. Die Erzählung verlangt schon in der ersten Hälfte Geduld. Das buchstäbliche Warten auf den Showdown, bei dem John in einer Hinterlandabsteige darauf harrt, dass Duell-Patronin Marla (Carolina Gómez, „Her Mother’s Killer“) mit dem Wagen vorfährt, kann die Längen aber unmöglich verleugnen. Das ändert sich mit Rourkes Erscheinen, der zunächst einen Vortrag über seinen Hauspapagei hält, durch seine Präsenz aber dennoch unweigerlich zur Aufwertung des Streifens beiträgt. Nachdem er über Kartellmilieu-Ausführungen zur Ursprungsverortung der Schusswechselkultur beitragen konnte, folgt der Zweikampf der Lebensmüden. Dass die am Ende auf Schutzwesten verzichten, mag ihr nihilistisches Naturell untermauern. An Überzeugungskraft gewinnt das Gesamtwerk darüber allerdings nicht. Über hehre Ambition greift die pseudo-poetische Sinnsuche damit einfach zu selten hinaus.
Wertung: 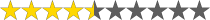 (4,5 / 10)
(4,5 / 10)
