
„People go missing around here, they’re gone for good. Outsiders come, they don’t know where to walk. They bring trouble. We just want to be left alone. And so does he.“ – Schauspielerin Rosemary Knower als „Crazy Ralph“-Ersatz
In Hollywood gehört es zum guten Ton, Filme nach ihrer Kinoauswertung in einer erweiterten Fassung zu präsentieren. Das kann wirtschaftliche Gründe haben, etwa bei Kürzungen, die eine geringere Alterseinstufung und damit eine bessere Vermarktung gewährleisten. Manchmal entsprechen die verlängerten Versionen auch der eigentlichen Vision des Regisseurs. In anderen Fällen erscheinen sie jedoch einzig als willkommenes Alibi, um das Publikum erneut zu ködern. Ein solches Beispiel ist das von den „Freddy vs. Jason“-Autoren Damian Shannon und Mark Swift ersonnene Reboot des Klassikers „Freitag der 13.“.
Anno 2009 brachte Regisseur Marcus Nispel, der sich sechs Jahre zuvor bereits der Modernisierung des „Texas Chainsaw Massacre“ angenommen hatte, Kult-Schlitzer Jason Voorhees einer neuen Generation nahe. Der von Blockbuster-Spezi Michael Bay („Transformers“) produzierte Schocker erwies sich als immens erfolgreich und spielte allein in den USA mehr als das Dreifache seiner Kosten wieder ein. Dabei wurden bereits früh Stimmen laut, die eine nachträglich verlängerte Fassung ankündigten und diese vollmundig als einschneidend verändert postulierten. Diese als „Killer Cut“ bekannte Nachlese bietet allerdings nur wenig Veränderndes. Und erst recht nichts Neues.
Aber zunächst zur Rekapitulation des Inhalts: Zum Auftakt bedient Nispel gleich sämtliche Klischees, wenn er eine Gruppe nicht mehr ganz so junger Urlauber (u. a. Ben Feldman, „Katakomben“) auf der Suche nach einer im tiefen Wald versteckten Marihuana-Plantage zur Ader lässt. Denn das Zielgebiet befindet sich unweit des verlassenen Ferienlagers am Crystal Lake, wo Jasons Mutter Jahre zuvor Betreuer meuchelte, um den Tod ihres Sprösslings zu sühnen, am Ende aber selbst den Kopf verlor. Diese Vorgeschichte wird in kurzen Einblendungen abgehandelt, wobei der „Killer Cut“ ein bisschen mehr vom noch kindlichen, unzweifelhaft deformierten Jason zeigt.
„Your tits are stupendous.“ – Wortgewandtes Arschloch: Trent
Die Eckpfeiler des Originals, dessen Regisseur Sean S. Cunningham bei Nispels Variante als Produzent fungierte, sowie der ersten Fortsetzung stützen auch die Neuformulierung des Themas. So trägt Jason (verkörpert von Stuntman Derek Mears, „The Hills have Eyes 2“) zunächst einen schmucklosen Sack auf dem Kopf, ehe er im Zuge eines Mordes auf die stilbildende Hockeymaske stößt. Aber zurück zur Einleitung, die neben den üblichen Genre-Dumpfbacken mit rapide schwindender Lebenserwartung „Final Girl“ Whitney (Amanda Righetti, „The Mentalist“) einführt. Während ihre Kumpelgesellschaft zwischen Drogenkonsum und Freizügigkeit – hier legt der „Killer Cut“ tatsächlich eine nutzlose Schippe drauf – ansehnlich rabiat ausgemerzt wird, bleibt ihr Schicksal zunächst ungeklärt.
Wochen später streift Clay Miller („Supernatural“-Star Jared Padalecki) durch die Pampa um den Crystal Lake, um die verschwundene Whitney, seine Schwester, zu suchen. Dabei stößt er zunächst auf die Clique von Jenna (Danielle Panabaker, „Mr. Brooks“) und ihrem schnöseligen Freund Trent (Travis Van Winkle, „Transformers“), ehe die Gesamttruppe in Jasons Jagdrevier gerät. Sympathisch erscheint neben Clay und der von Jason im Tunnelverlies unter dem Sommer-Camp festgehaltenen Whitney – der „Killer Cut“ enthält eine erzählerische Erweiterung, bei der ihr die zwischenzeitliche Flucht gelingt – lediglich Jenna. Der Rest entpuppt sich als rundheraus idiotisches Schlachtvieh, dessen übertriebene Anmutung nicht einmal vor Nacktmagazinen ableckenden Hinderwäldlern zurückschreckt.
Mehr noch als bei den lose zitierten Vorgängern schlägt sich der Zuschauende zwangsläufig auf die Seite Jasons. Die um dessen Bluttaten kreisende Inszenierung gibt sich betont dreckig. Allerdings wird die offenkundige Anlehnung ans Terrorkino der 70er durch Nispels Hang abgeschwächt, neben rasanten Schnitten auf verwackelte Bilder zu setzen. Schlechter ist der Film über die letzte Dekade sicher nicht geworden. Wesentlich besser allerdings auch nicht. Der zunächst allein in den USA veröffentlichte und erst seit 2017 auch in Deutschland erhältliche „Killer Cut“ gibt dem um rund zehn Minuten verlängerten Streifen im Detail aber zumindest die grobe Härte, die vom Thema zu erwarten ist. Die Orientierung am gängigen Slasher-ABC darf dabei sicher als Hommage verstanden werden – oder auch einfach als Indiz akuter Ideenlosigkeit.
Wertung: 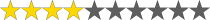 (4 / 10)
(4 / 10)
