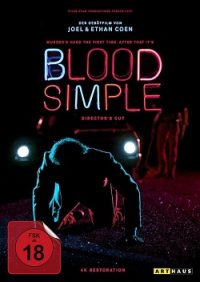 „Never point a gun at anyone, unless you mean to shoot him. And if you shoot him, you better make sure he’s dead.“ – Ray
„Never point a gun at anyone, unless you mean to shoot him. And if you shoot him, you better make sure he’s dead.“ – Ray
Eine Frau will ihren Mann verlassen. Doch sie zögert. Denn er ist herrisch, aufbrausend, wirkt mitunter gar manisch. Um zu entkommen, setzt sie auf die Hilfe eines seiner Angestellten. Sie beginnt ein Verhältnis mit ihm, was durch einen vom Gatten engagierten Privatschnüffler auffliegt. Die aus dieser Grundkonstellation abgeleitete Dreiecksgeschichte ist typischer Krimi-Stoff, bei dem die Zuspitzung in Form von Mordplänen nicht lange auf sich warten lässt. „Typisch“ ist als Einordnung von „Blood Simple“ jedoch ein vollends unpassender Begriff. Der Film ist ein Meisterwerk, was umso verblüffender erscheint, da es sich um ein unabhängig produziertes Debüt handelt. Allerdings heißen die Verantwortlichen Joel und Ethan Coen. Wundern sollte einen da eigentlich nichts mehr.
Am Skript feilten die brillanten Auteure rund zwei Jahre. Dazwischen stemmten sie die Finanzierung über eigens akquirierte Geldgeber, die mit einem Fake-Trailer geködert wurden, der eine vage Ahnung von der Tonalität des späteren Resultats vermitteln sollte. Dass es die fulminante Hommage an den Film Noir je ins Kino schaffen würde, blieb ein ferner Traum. Am Ende, mit einiger Verspätung, wurde er Realität – und zementierte die beispiellose Karriere der Coens. Die entschlossen sich knapp 15 Jahre nach der Uraufführung, einen Director’s Cut ihres Erstlings anzufertigen. Das Ungewöhnliche daran: Die mittlerweile erfahrenen Filmemacher strafften die Erzählung und kürzten ihr Debüt um rund vier Minuten ein. Das Ergebnis ist nicht allein dynamischer, sondern durch blutige Details auch brutaler. Die Erwachsenenfreigabe bleibt trotzdem nur schwerlich nachvollziehbar.
Wie das Gros der Beteiligten hinter der Kamera waren auch die Darsteller nahezu unbekannt: Frances McDormand kam frisch von der Schauspielschule und schnappte Holly Hunter, die im Coen-Zweitwerk „Arizona Junior“ (1987) den weiblichen Hauptpart übernehmen sollte, die Rolle der Abby weg. Die Coens konnten auf ihre wegen eines Theater-Engagements gebundene erste Wahl einfach nicht warten. Für McDormand sollte es ein schicksalhafter Einstand in die Schauspielerei werden: Im selben Jahr der Produktion heiratete sie Joel Coen, spielte in vielen der von ihm mitverantworteten Werke mit und erhielt für ihre Darbietung in „Fargo“ 1997 einen Oscar. Der Mann an ihrer Seite ist John Getz („Die Fliege“). Der Auftakt zeigt die beiden in Rückansicht im Auto. Sie will weg, er soll sie fahren.
„Gimme a call whenever you wanna cut off my head. I can always crawl around without it.“ – Visser
Die beständig genährte Anspannung wird bereits in den ersten Momenten erfahrbar. Sie prägt „Blood Simple“, neben der suggestiven Bildsprache zwischen Neonlicht und Halbschatten, am nachhaltigsten. Der Grund für Abbys Ausbruch ist Marty (Dan Hedaya, „Begierde“), der im texanischen Hinterland eine Bar betreibt und mit finsterem Blick gern den großen Mann markiert. Von Privatschnüffler Loren Visser (M. Emmet Walsh, „Silkwood“), der mit beigem Anzug und Panamahut bleibende Eindrücke hinterlässt, erhält er den (Foto-)Beweis für Abbys Affäre. Aus diesem leitet sich bald ein Mordauftrag ab. 10.000 Dollar für zwei Leben. Sparsamer geht es kaum. Doch Visser willigt ein, offenbart bei der Ausführung jedoch eigene Pläne, die eine mörderische Spirale in Gang bringen, an deren Ende einzig der Zuschauer weiß, wie es tatsächlich dazu kam.
Kongenial variieren die Coens Motive aus Film Noir und klassischen Hard-Boiled-Krimis der 70er. Momentweise scheuen sie nicht einmal vor Elementen des Horrorfilms zurück. „Blood Simple“ ist Exploitation in Reinform, wächst durch die Kunstfertigkeit seiner Schöpfer aber weit über bloßes, auf Effekt ausgerichtetes Kino hinaus. Das bisweilen attestierte parodistische Potential würde dieser Leistung kaum gerecht. Vielmehr vermitteln die Coens eine höchst eigenwillige, zweifelsfrei schwarzhumorige Perspektive auf die Eigenheiten des Thrillers und verorten diese irgendwo zwischen Alfred Hitchcock und Krimi-Autor James M. Cain („Wenn der Postmann zweimal klingelt“).
Die Extravaganz des gediegen erzählten Geniestreichs offenbart sich durch geschliffene Dialoge, mitunter absurd-unvorhersehbare Verhaltensweisen der Figuren (man beachte etwa die Beerdigung im Acker) sowie einfallsreiche Kamerafahrten. Der spätere „Man in Black“-Regisseur Barry Sonnenfeld, der zuvor an Porno-Produktionen beteiligt war, hat großen Anteil an der Atmosphäre. Ein echter Höhepunkt ist die Kamerafahrt über die Bar, bei der ein im Wege liegender Betrunkener einfach „übersprungen“ wird. Im starken, aus Kostengründen wohlgemerkt sehr überschaubaren Ensemble spielt sich M. Emmet Walsh als kauzig-schmieriger Privatschnüffler im rostigen VW-Käfer (in „The Big Lebowski“ variierten die Coens dies Motiv mit Jon Polito) nach vorn. Doch nicht nur er bleibt denkwürdig. Es ist der herausragende Indie-Thriller als Ganzes, der bis heute, erst recht im Director’s Cut, vollends begeistert.
Wertung:  (8,5 / 10)
(8,5 / 10)
