 Michael Fassbender ist ein großartiger Schauspieler. Der Charakterdarsteller mit deutschen Wurzeln beweist konstant, dass er zu den derzeit wandlungsfähigsten Akteuren Hollywoods zählt. Neben kleinen Produktionen wie „Shame“ (2011) oder „Frank“ (2014) zählen immer häufiger Blockbuster zu seinem Repertoire. Als Flöte spielender Android in „Alien: Covenant“ (2017) machte er jedoch deutlich, dass in Sachen Qualität noch Luft nach oben besteht. Die wird auch durch „Assassin’s Creed“ nicht reduziert, der mäßigen und vorrangig mäßig aufregenden Verfilmung der erfolgreichen Videospiel-Serie gleichen Namens.
Michael Fassbender ist ein großartiger Schauspieler. Der Charakterdarsteller mit deutschen Wurzeln beweist konstant, dass er zu den derzeit wandlungsfähigsten Akteuren Hollywoods zählt. Neben kleinen Produktionen wie „Shame“ (2011) oder „Frank“ (2014) zählen immer häufiger Blockbuster zu seinem Repertoire. Als Flöte spielender Android in „Alien: Covenant“ (2017) machte er jedoch deutlich, dass in Sachen Qualität noch Luft nach oben besteht. Die wird auch durch „Assassin’s Creed“ nicht reduziert, der mäßigen und vorrangig mäßig aufregenden Verfilmung der erfolgreichen Videospiel-Serie gleichen Namens.
Deren Probleme beginnen bereits bei der kruden Prämisse: Seit Jahrhunderten sucht der Orden der Tempelritter nach einem mystischen Artefakt, dem „Apfel von Eden“. Mit diesem kann der freie Wille der gesamten Menschheit kontrolliert werden. Wie jetzt? Einfach so? Der Film will es uns suggerieren. Gelingen will es nicht. Im Wege steht dem vermessenen Weltherrschaftsanspruch die Bruderschaft der Assassinen. Die erhalten die Ordnung jenseits moralischer und juristischer Grenzen durch gezieltes Morden aufrecht. Wo die Aufklärung versagt, hilft naturgemäß nur noch Waffengewalt.
In der Gegenwart sind die Methoden der Templer subtiler geworden, das Ziel jedoch ist geblieben. Um dieses zu erreichen, hat Dr. Sofia Rikkin (Marion Cotillard, „Inception“) den Animus geschaffen, eine hochtechnisierte Maschine, mit der Menschen per DNA-Abgleich Momente aus dem Leben verstorbener Vorfahren nachempfinden können. Wie das funktioniert, bleibt das Geheimnis der Skriptschreiber, die das visuell ansehnliche Prozedere so vage wie irgend möglich halten. Einer der für die mentale Zeitreise auserkorenen Probanden ist Cal Lynch (Fassbender), der eigentlich in einem texanischen Gefängnis hingerichtet werden soll.
Da er jedoch ein direkter Ahn des altspanischen Attentäters Aguilar (auch Fassbender) ist, soll er für Sofia und deren Vater Alan (Jeremy Irons, „Red Sparrow“) den Verbleib des magischen Wunderobstes klären. So wird er nach seiner fingierten Exekution in ein futuristisches Forschungszentrum in Madrid gebracht, wo allerlei Assassinen-Nachfahren – darunter Michael K. Williams („The Wire“) und Matias Varela („Narcos“) – gefangen gehalten werden. Was das soll? Wohin es führt? Nebensache. Der Plot ergeht sich in Andeutungen, die zwar allerlei Fragen aufwerfen, Antworten jedoch beständig schuldig bleiben. Das große Versagen von Regisseur Justin Kurzel (drehte mit Fassbender auch „Macbeth“) besteht aber insbesondere darin, dass selbst die durch Stakkatoschnitte verhunzte Action nicht überzeugt.
So positiv das Bestreben erscheint, mehr als gängige Unterhaltungsformeln bieten zu wollen, die Komplexität der wirren Geschichte bleibt reine Einbildung. Denn natürlich widersetzt sich Cal schlussendlich der Instrumentalisierung durch die Templer und tritt in Aguilars Fußstapfen. Die hochglänzenden Bilder werden von Dialogen umgarnt, die in ihrer Bedeutungsschwere oftmals lächerlich wirken. Das ist umso bedauerlicher, da auch aus prominenten Nebendarstellern wie Charlotte Rampling („Melancholia“) als Templer-Vorsitzende oder Brendan Gleeson („Im Herzen der See“) als Cals konfliktbeladener Vater keinerlei Profit geschlagen wird.
Das von Frank Marshall („Sully“) und Hauptakteur Fassbender produzierte Genre-Potpourri versagt auf nahezu allen Ebenen. Cals Charakter erhält keinen nennenswerten Hintergrund und erst recht keine Wesenszüge, die den Zuschauer Anteil an seiner Wandlung vom Zuhälterkiller zum Weltenretter nehmen lassen würde. So bleibt ein gescheitertes Werk ohne funktionierende Hauptfigur – und ohne klassischen Showdown. Der bleibt zugunsten einer Fortsetzung aus. Darin liegt der eklatante Irrtum der Macher, die wahrhaftig geglaubt haben, dieser mit Einstellungen fliegender Greifvögel überladende Murks wäre vom Fleck weg für ein zweites Kapitel prädestiniert.
Wertung: 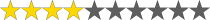 (4 / 10)
(4 / 10)
