
„It doesn’t matter who you are. We’Ve all got something that you don’t want anyone else to know about. Something that you’re ashamed of.“ – John Luther
John Luther ist zurück. Pläne für eine Filmversion der BBC-Erfolgsserie wurden seit Jahren gehegt, jedoch immer wieder verworfen. Gemessen an der Qualität des schlussendlich in Kooperation mit Netflix entstandenen Ergänzung der Gesamtgeschichte erscheint das kaum verwunderlich. Denn „Luther: The Fallen Sun“ ist streckenweise derart überzogen, dass selbst beinharte Fans des Formats um den Nachhall ihres Antihelden fürchten müssen. Mehr noch wirkt der Streifen wie ein Empfehlungsschreiben für Hauptdarsteller Idris Elba („The Harder They Fall“), um sich bei der James-Bond-Nachfolge in Stellung zu bringen.
Der Fairness halber muss vorangestellt werden, dass auch die zwischen 2010 und 2019 produzierten fünf Staffeln ihre Schwächen aufweisen. So hinken die dramatischen Nebenplots regelmäßig hinter den mit durchaus glaubhaften Milieuschilderungen versehenen Kriminalfällen zurück. Dieses Gegengewicht kommt dem Film jedoch abhanden. Das wirkt durch die Beteiligung von Serienschöpfer, -autor und -produzent Neil Cross („Mama“) nur umso unverständlicher. Anflüge von Authentizität werden durch überdramatisierte Dialoge und auf bloßen Zufällen wurzelnde Wendungen übertüncht. Dabei zeigt der stimmungsvolle Auftakt, eine durch Erpressung orchestrierte Entführung, dass „The Fallen Sun“ auch positive Aspekte vorweisen kann.
Der Täter, ein absurd figuriertes kriminelles Mastermind, in dessen Rolle Motion-Capture-Ikone Andy Serkis („Der Herr der Ringe“) mit Harald-Juhnke-Gedächtnis-Erscheinung auf Unscheinbarkeit pocht, entstammt unverkennbar dem „Sieben“-Baukasten. Jener Tech-Millionär David Robey scheut weder Aufwand noch jahrelange Vorbereitung, um eine öffentlichkeitswirksame Mordserie in Gang zu bringen. Im Wege scheint lediglich Luther zu stehen, der einen Umschnitt später durch Publikmachung seiner mannigfaltigen Vergehen (siehe Staffel eins bis fünf) im Knast landet. Warum ausgerechnet Luther als größter Gefahrenherd für die willkürlich erscheinenden Bluttaten auserkoren wird, bleibt Cross‘ Geheimnis. Es genügt bereits, dass Robey den einleitenden Tatort besucht und bezeugt, dass Ermittlungsleiter Luther der Mutter (Hattie Morahan, „Enola Holmes“) des Verschleppten schwört, ihren Sohn lebend zu finden.
„I’m still a copper.“ – John Luther
Nach dem ausgesparten Prozess samt Verurteilung schwebt Luther im Gefängnis naturgemäß in Lebensgefahr. Das macht er sich zunutze, als ihm Robey eine Botschaft zukommen lässt, die den gefallenen Cop zur Flucht nötigt, um den übermächtigen Proto-Bösewicht auf eigene Faust zu schnappen. Dass der Ausbruch gelingt, ist allein der haltlosen Übertreibung eines Skripts zu verdanken, das beharrlich auf Logik pfeift. Durch die teils überhastete Manier, in der TV-Routinier Jamie Payne („Outlander“) den Plot in 130 Minuten abhandelt – es stellt sich die Frage, warum eine sorgfältigere Ausbreitung als Miniserie keine Option war – bleibt aber ohnehin kaum Zeit zum Verschnaufen. Das Untertauchen fällt nicht schwer, da das britische öffentliche Überwachungssystem nur dann funktioniert, wenn es zur Spannungserzeugung dienlich erscheint.
Um Luther zu fassen, setzt dessen Nachfolgerin bei der Polizei, DCI Odette Raine (Cynthia Erivo, „Harriet“), auf die Unterstützung von Martin Schenk (als Anknüpfungspunkt an die Serie ein Lichtblick: Dermot Crowley, „The Foreigner“), dem vorzeitig verrenteten Ex-Vorgesetzten des eigenmächtig ermittelnden Ausbrechers. Dass die beiden über alle Querelen hinweg am Ende paktieren, versteht sich von selbst. Bis es aber soweit ist, rumpelt die Geschichte über eine forcierte Selbstmordserie am abendlichen Piccadilly Circus, einen Maulwurf bei der Polizei sowie die Entführung von Raines Tochter einem in jeder Hinsicht frostigen Ausklang entgegen. Der verschlägt sie und Luther nach Norwegen, ins eisige Ödland, wo sich ein Showdown zwischen Bond und Stieg Larsson entspinnt. Dabei beweist Luther Qualitäten als Übermensch, wenn ihm Schnee und Eiswasser trotz Minimalgarderobe nichts anhaben können.
Selbst Robeys teuflischer Plan erweist sich letztlich als schnöde „Untraceable“-Kopie, was insbesondere den zeitlichen Invest ad absurdum führt. Genau das ist das grundlegende Problem von „The Fallen Sun“: Zu wenig ergibt Sinn. Dabei ist es nicht so, als würde der handwerklich souverän auf düstere Atmosphäre getrimmte Nachklapp nicht unterhalten. Nur wird dabei besser kein Gedanke an die marginale Substanz verschwendet. Der Besetzung ist indes kein Vorwurf zu machen; sie wird von Cross schlicht im Stich gelassen. Dabei nutzt immerhin Serkis die Möglichkeiten für eine zügellose Performance am Rand der Parodie. Diesen Wesenszug stützt auch die Schlussszene, bei der nicht einmal verwundern würde, wenn der Bond-Vorgesetzte M zu Luthers Überführung in neue Aufgabenfelder beitragen würde. Weniger wäre auch in diesem Falle eindeutig mehr gewesen.
Wertung: 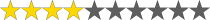 (4 / 10)
(4 / 10)
