 Das praktisch nicht tot zu kriegende Genre des Slasherfilms hat seinen Zenit wiederholt überschritten. Einer der Hauptverantwortlichen für die durch Wes Cravens „Scream“ eingeläutete Renaissance ist Autor Kevin Williamson. Er verfasste die Drehbücher zu den ersten beiden „Scream“-Teilen, erdachte „The Faculty“ und schrieb „Ich weiß was du letzten Sommer getan hast“. Als Regisseur des letztgenannten tat sich Jim Gillespie hervor, der nach der verunglückten Schlitzer-Action „D-Tox“ bald in der Versenkung verschwand. Sein Comeback sollte der von Williamson produzierte „Venom“ sein, eine weitere Führung adretter Twens zum filmischen Schafott. Kurzum, der Streifen war ein kolossaler Flop im US-Kino und angesichts der schwachbrüstigen Schlachtplatte nicht mehr als der Beweis dafür, dass der schematische Teenie-Horror einmal mehr eine kreativ kommerzielle Talsohle durchschreitet.
Das praktisch nicht tot zu kriegende Genre des Slasherfilms hat seinen Zenit wiederholt überschritten. Einer der Hauptverantwortlichen für die durch Wes Cravens „Scream“ eingeläutete Renaissance ist Autor Kevin Williamson. Er verfasste die Drehbücher zu den ersten beiden „Scream“-Teilen, erdachte „The Faculty“ und schrieb „Ich weiß was du letzten Sommer getan hast“. Als Regisseur des letztgenannten tat sich Jim Gillespie hervor, der nach der verunglückten Schlitzer-Action „D-Tox“ bald in der Versenkung verschwand. Sein Comeback sollte der von Williamson produzierte „Venom“ sein, eine weitere Führung adretter Twens zum filmischen Schafott. Kurzum, der Streifen war ein kolossaler Flop im US-Kino und angesichts der schwachbrüstigen Schlachtplatte nicht mehr als der Beweis dafür, dass der schematische Teenie-Horror einmal mehr eine kreativ kommerzielle Talsohle durchschreitet.
Die unsinngemäße Riege von Schönheit überstrahlter Figuren – u.a. verkörpert durch Agnes Bruckner („Mord nach Plan“) und Jonathan Jackson („Riding the Bullet“) – ist diesmal in einem schmierigen Kaff in den Sümpfen Louisianas ansässig. In dieser Hochburg degenerierter Rednecks wimmelt es geradezu von jungen wie attraktiven Gestalten, deren konstruierte Problemwelten selbst den Skriptklempnern täglicher Seifenopern hochpeinlich wären. Aber es ist, wie es war: Bevor die Bagage ins Joch des adulten Daseins gezwängt wird, reduziert ein wahnsinniger Killer deren Bestand um ein Beträchtliches. Hier ist es Trucker Ray (Rick Cramer, „Showdown in Little Tokyo“), der durch ein Missgeschick von den beseelten Schlangen der örtlichen Voodoopriesterin gebissen wird. So verwandeln ihn die Reptilien in eine Kreatur von stattlicher Hässlichkeit und gehen munter ans Werk, der Jugend das Leben zu rauben.
„Venom“ ist ein ansehnlich inszenierter, obgleich hochgradig dämlicher Slasherfilm, dessen mangelnde Sinnhaftigkeit nur noch von der gesteigerten Klischeebelastung übertroffen wird. Das Ambiente der unheimlichen Sumpflandschaft genügt für ein Mindestmaß an Atmosphäre, in Anbetracht der dullen Chargen und der allgegenwärtigen Einfalt kommt dies aber kaum zur Geltung. Routinier Jim Gillespie begnügt sich mit hinreichend bekannter Flickschusterei, vergisst seinen rasch siechenden Protagonisten über die üppige charakterliche Montage aber ein eigenes Profil zu verpassen. Die räumlich isolierten Sprechpuppen werden blutig, wenn auch meist außerhalb des Sichtfeldes frikassiert, ohne das der Reiz an comichafter Gewalt je über die Beliebigkeit des Aufgezeigten triumphieren könnte. Im Mittelteil wird gekreischt, was die Kehlen hergeben, im Finale auf den Sand des Mystizismus gebaut. Das Ende belässt den standesgemäßen Freiraum für einen Nachklapp, der uns aufgrund des redlich verdienten Misserfolgs gottlob erspart bleiben dürfte.
Wertung: 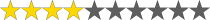 (4 / 10)
(4 / 10)
