 „Ladies and gentlemen, when you come to my house, you are stripped. This show is about what’s on the inside, what is inside you. Is it beautiful? Or is it ugly?” – Wortgewandt: Magier Montag
„Ladies and gentlemen, when you come to my house, you are stripped. This show is about what’s on the inside, what is inside you. Is it beautiful? Or is it ugly?” – Wortgewandt: Magier Montag
Wer sich Gore-Hound schimpft, muss zwangsläufig mit dem Namen Herschell Gordon Lewis in Verbindung gekommen sein. Immerhin genießt der amerikanische Filmemacher den Ruf des Pioniers des Splatterfilms. Sein 1963er „Blood Feast“ gilt gar als erster Genrebeitrag der Filmgeschichte. Neben dem Southploitationer „Two Thousand Manicas!“ (1964) gehört das Schlachtfest „The Wizard of Gore“ (1970) zu den bekanntesten Werken des Godfather of Gore. Den ersten beehrte man schon 2005 mit einem Remake (plus armseligem Sequel fünf Jahre später), ein Jahr darauf folgte die Wiederaufbereitung der absurden Zaubershow um Magier Montag, welcher die allseits beliebte Nummer der zersägten Jungfrau sehr wörtlich interpretiert.
Im Remake wird der „Ausnahme“-Künstler vom grandiosen Crispin Glover („Zurück in die Zukunft“) verkörpert. Der über die Bühne tänzelnde Magier zerrt gerne junge Frauen aus dem Publikum und bewegt sie mit seinem hypnotischen Blick und geflügeltem Wort zum ausziehen. Ist frau der lästigen Textilien entledigt, geht es ans Eingemachte. Wortwörtlich. Ist das Nackedei darauf ausgeweidet, verlodert oder sonst wie geschändet, hat das Publikum kurz Zeit im Schock-Zustand auszuharren, bis Montag die zuvor Massakrierte quicklebendig hinterm Vorhang hervorholt. Weniger erfreulich bleibt für die eingebundenen Assistentinnen, dass sie einen Tag nach der Show tot aufgefunden werden.
Wie sich herausstellt, sind die jungen Damen allesamt an Verletzungen gestorben, die ihnen Montag am Abend zuvor beschert hat. Oder eben auch nicht. Journalist Edmund Bigelow (Kip Pardue, „Hostel 3“) versucht der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Ein Remake im klassischen Sinne ist „Wizard of Gore“ damit nicht. Der titelgebende Illusionist ist geblieben, der Rest ist komplett neu hinzugedichtet. Lewis´ Filme genießen keinen Kultstatus, weil sie ausgeklügelte Stories oder Oscar-würdiges Schauspiel zu bieten hätten. Eine noch so mickrige Geschichte um all das Gedärm und den blanken Busen ist sicherlich nicht verwerflich, doch so abstrus kompliziert wie in Jeremy Kastens („The Attic Expeditions“) Neuinterpretation muss sie dann auch nicht geraten sein.
Selbst der Versuch, Lewis durch eine Palette an Splattereffekten Reminiszenz zu zollen, ist nur bedingt als gelungen zu bezeichnen. Die Bühnengemetzel findend allesamt hinter einer in Nebel gehüllten Glasplatte statt, so dass man nur vage zu sehen bekommt, was dahinter tatsächlich geschieht. Ein kompletter Rohrkrepierer ist der neue „Wizard of Gore“ trotz der konfusen Story sicherlich nicht. Hier und da hat der Streifen seine Momente – vor allem, wenn Glover über die Bühne gleitet. Die Kurzauftritte der Genre-Größen Drad Dourif („Chucky“) und Jeffrey Combs („Re-Animator“) sind auch gern gesehen. Nur ist dieser „Wizard of Gore“ eben leider kein echter „Wizard of Gore“. Mehr als Lewis´ „Gore Gore Girls“ oder „Blood Feast“ hat er aber allemal zu bieten. Wer diese Werke kennt wird wissen, dass der vorangehende Satz kein Sakrileg ist!
Wertung: 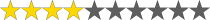 (4 / 10)
(4 / 10)
