 Katastrophenfilme sind immer auch Ensemblefilme. Die den Folgen einer verheerenden Naturgewalt ausgesetzten Protagonisten müssen im Wettlauf gegen die Zeit Einigkeit beweisen, um der allgegenwärtigen Gefahr zu trotzen. Einige von ihnen sterben. Es bleibt der bleiernen Dramatik zu schulden. David Neams Genreklassiker „Poseidon Inferno“ (1972) besitzt Vorbildcharakter. Ihm folgten bis in die späten Neunziger dutzende Epigonen. Die unvermeidliche Neuverfilmung des Stoffes, basierend auf einem Roman von Paul Gallico, besorgt Wolfgang Petersen („Troja“). Ihm obliegt Erfahrung mit der peitschenden See, brachte der in Hollywood tätige Emdener doch bereits „Das Boot“ und „Der Sturm“ auf die Leinwand.
Katastrophenfilme sind immer auch Ensemblefilme. Die den Folgen einer verheerenden Naturgewalt ausgesetzten Protagonisten müssen im Wettlauf gegen die Zeit Einigkeit beweisen, um der allgegenwärtigen Gefahr zu trotzen. Einige von ihnen sterben. Es bleibt der bleiernen Dramatik zu schulden. David Neams Genreklassiker „Poseidon Inferno“ (1972) besitzt Vorbildcharakter. Ihm folgten bis in die späten Neunziger dutzende Epigonen. Die unvermeidliche Neuverfilmung des Stoffes, basierend auf einem Roman von Paul Gallico, besorgt Wolfgang Petersen („Troja“). Ihm obliegt Erfahrung mit der peitschenden See, brachte der in Hollywood tätige Emdener doch bereits „Das Boot“ und „Der Sturm“ auf die Leinwand.
Dass ein Remake seinem Original das Wasser reichen kann, ist die Ausnahme. Auf Petersens „Poseidon“ trifft das nicht zu. Mit tricktechnischer Perfektion nimmt die Katastrophe ihren Lauf und lässt den computeranimierten Passagierschiffgiganten nach einer verheerenden Flutwelle kieloben auf dem offenen Meer treiben. Der technisierte Klotz ist Spielplatz der Reichen und Schönen. Der mit Prunk zelebrierte Jahreswechsel bedeutet für viele den Tod. In ihr unweigerliches Schicksal ergeben will sich die bunt zusammengewürfelte Truppe um den Feuerwehrhelden und Ex-Bürgermeister Kurt Russell („Die Klapperschlange“) nicht. Warum Petersen halbherzig in den Wunden des 11. September bohrt, bleibt ungewiss. Für den Film bedeutet es nur, dass der erfahrene Brandbekämpfer im Vorhang den Nutzen des Sprungtuchs erkennt und den Leidensgenossen die tödliche Gefahr einer Feuerwalze erklären kann. Danke dafür.
Der Weg führt nach oben, zu den Schiffsschrauben am Bug. Dort ist bekanntlich der Notausgang. Die charakterlichen Stereotypen sind ein Standard im Regelwerk des Katastrophenabenteuers. Über so wenig Profil wie hier verfügten sie selten. Josh Lucas („Stealth“) ist der heldenhafte Draufgänger, der von Altersflecken gezeichnete Richard Dreyfuss („Mr. Hollands Opus“) der Schwule mit Brilli im Ohrlappen, Matt Dillons Bruder Kevin („Platoon“) der zynische Stinker mit Namen Lucky Larry. Der Rest sind Mütter, Kinder und Migranten (u.a. Freddy Roddriguez, „Six Feet Under“). Als er gerade beginnt, sein Nervpotential zu entfalten, wird Larry von einem Trümmerteil erschlagen. Schade ist es nicht um ihn. Die Einheitsfiguren bleiben verzeihlich, die hochgradig dämlichen Dialoge nicht.
Es ist nicht alles schlecht, aber nur wenig gut. Die meisten Effekte entstanden am Computer. Der voll digitalisierte Actionfilm lauert mit seiner Künstlichkeit hinter jedem Trümmerhaufen. Petersen emotionalisiert nach den Regeln des Kinos. Natürlich müssen Sympathieträger sterben. Aber haben Figuren überhaupt unsere Sympathie verdient, die in ihrer akuten Unglaubwürdigkeit nicht minder künstlich hergestellt scheinen als die digitalen Explosionen und Flammenmeere? Die Kalkulierbarkeit des Szenarios bedingt nicht nur das Original. Das zumindest war spannend. Der Neuaufguss ist es nicht. Katastrophenfilme sind immer auch Ensemblefilme. Was bleibt, wenn das Ensemble versagt, veranschaulicht dieser katastrophale Film.
Wertung: 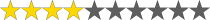 (4 / 10)
(4 / 10)
