 Und Gott sah, dass es Trash war…
Und Gott sah, dass es Trash war…
Es gibt wohl kaum ein filmbeflissenes Individuum, das beim Namen Albert Pyun nicht mit vor Pein geweiteten Pupillen die Hände gegen die Fontanelle schlägt. Titel und Inhalte von Machwerken wie „The Sword and the Sorcerer“, „Ravenhawk“ oder „Ticker“ sprechen dabei eine mehr als deutliche Sprache. Was also macht den Reiz dieses verruchten wie verlachten Filmemachers aus? Die Antwort auf diese im Grunde törichte Frage erweist sich als simpel, verrichtet der gebürtige Hawaiianer doch schlicht seit mehr als zwei Dekaden unbeirrt sein Tagewerk. Natürlich gehört Albert Pyun in scharlachroten Lettern das Wort „Stümper“ auf die Weste gebügelt, jedoch nicht ohne zuvor ehrfürchtigen Respekt vor den minderen Verdiensten dieses Ausnahmeinszenators gezollt zu haben. Da es allerdings einiger Überwindung bedarf, sich die mehr als drei Dutzend (!) unter seiner Direktion entstandenen Prunkwerke zu Gemüte zu führen, sei an dieser Stelle lediglich auf eines seiner herausragendsten Werke verwiesen, nämlich den 1997 entstandenen Action-Thriller „Mean Guns“.
In diesem tischt der Maestro der kruden Unterhaltung u.a. das erste Zusammenspiel mit Rapper Ice-T auf, mit dem Pyun bis dato stolze sechs Filme (u.a. „Crazy Six“) drehte. Neben diesem treten gestandene Mimen wie „Ultimate Chase“-Dauerläufer Christopher Lambert oder Deborah Van Valkenburgh („The Warriors“) in Erscheinung. Doch welch unsägliche Räuberpistole dem geneigten Zuschauer mit „Mean Guns“ vorlegt wird, spottet wahrlich jeder Beschreibung ambitionierter Filmproduktion. Und doch verbreitet der absurde B-Trash derart gute Laune, dass er nicht nur im gesammelten Naschwerk des Regisseurs in vorderster Front einen Ehrenposten bezieht, sondern auch einen der triumphalsten Thronanwärter im ewigen Olymp erheiternder Filmgurken verkörpert. Wessen Äuglein könnten schon im Angesicht Christopher Lamberts trocken bleiben, der mit wehendem schwarzen Mantel und überbordender Coolness einen metallenen Baseball-Knüppel gegen die Leiber seiner Opponenten schwingt, während Dutzende Schergen zu heißen Mamborhythmen im Kugelhagel perforiert werden?
Auslöser für dieses muntere Scheibenschießen bildet das weltweit operierende Verbrechersyndikat des gefürchteten Gangsterbosses Moon (mit grandios-grantigen Wutwülsten über der Nase: Ice-T), der die 100 gefährlichsten Killer der Welt in einem kurz vor der Eröffnung stehenden High-Tech-Gefängnis zusammentreibt. Jeder der Anwesenden hat das Netzwerk der Organisation hintergangen, so dass die gerechte Strafe einen bleihaltigen Kampf auf Leben und Tod repräsentiert, an dessen Ende lediglich drei Überlebende stehen sollen. Den Siegern winkt eine Prämie von 10 Millionen Dollar, während den Verlierern einzig der Tod blüht. So wird der Abschaum ausgesandt, sich bis an die Zähne bewaffnet zu bekriegen, um der natürlichen Auslese des Stärkeren genüge zu tun. Dabei kommen Kameraführung und Schnitt noch überraschend gut weg, so dass sich das trashige Amüsement in der Hauptsache aus dem gnadenlosen Overacting der Darsteller speist.
Allen voran Aushilfsmime Ice-T agiert derart aufgesetzt, dass er jeden abgefeuerten Schuss förmlich aus seiner Puste zu schütteln versucht und obendrein solch gruftige Einzeiler wie „Möge der tödlichste gewinnen“ durch versilberte Zahnreihen in die Runde schmettert. Anbei bedient sich „Mean Guns“ bei Regie-Großmeistern wie Sergio Leone, John Woo oder Quentin Tarantino. Wenn beispielsweise die Namen von Cast und Crew unter Beschuss ins Bild der Anfangstitel gesprengt werden, der Dialogaufbau philosophierende Gangster aufzeigt und Protagonisten wild feuernd in Zeitlupe Treppengeländer herunterschlittern, sind die plagiierten Vorbilder mehr als offensichtlich. Dass der Logikquotient dieses feisten Ramsches aus gänzlich unblutigen Schusswechseln, unterirdischen Dialogen und amoklaufenden Plotlöchern beständig gen Abwassersystem driftet, versteht sich beinahe von selbst. doch gerade darum schüttelt Pyun in loser Folge neuerliche Höhepunkte zum brüllen komischer Szenenfolgen aus seinen nimmermüden Ärmelchen.
Allein Kimberly Warrens nach einer explosiven Verpuffung eines Aktenkoffers (!) rußgeschwärztes Gesicht (!!) und in Flammen stehendes Haupthaar (!!!) sind ein echter Brüller. Die Kombination jener Ereignisse nötigt sie dazu, wie ein Flummi gegen angrenzende Metallschränke zu titschen, um schließlich mit dem Kappes die Vorderfront eines Lagermobiliars zu durchbrechen und abzutreten. Ein treffliches Beispiel dafür, welch abwegige Früchte der Irrsinn in „Mean Guns“ trägt. Ganz zu Schweigen von der High-Tech-Inhaftierungsanstalt, die zwar geräumige Küchen, Umkleideräume, Bohrmaschinen, freistehende Pissbecken (???) und geräumige Treppenhäuser bietet, dafür aber keinerlei Zellentrakt. Aber billig bleibt billig, so dass der Irrsinn bei dieser actionreichen Gangster-Farce konsequent vorgelebt wird – miserable deutsche Synchronisation und Mambo-Soundtrack inklusive. Eine quietschvergnügte und absolut denkwürdige Trash-Perle!
Wertung: 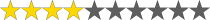 (4 / 10)
(4 / 10)
