 „Maybe he is in the swamp, and maybe the swamp is in him.“
„Maybe he is in the swamp, and maybe the swamp is in him.“
„Spider-Man“, „Batman“ oder die „X-Men“, alles Namen von avancierten Heroen, die nicht nur Vollblut-Comicnerds ein Begriff sind. „Man-Thing“ hingegen dürfte nur den wirklichen Kennern der Materie bekannt sein. Fans des Ebengenannten dürfen sich nun auch über die Adaptation ihres Lieblings freuen. Oder auch nicht. Denn was der Filmemacher Brett Leonard hier auf die ahnungslose Menschheit loslässt, stellt sogar andere Werke von ihm, solche wie „Highlander: The Source“ oder „Siegfried & Roy: The Magic Box“, in den Schatten.
Die Geschichte ist schnell erzählt: Sheriff Williams (Matthew La Nevez, auch in Leonards „Feed“ zu sehen) kommt in eine am Sumpf gelegene Stadt, die durch einem profitgierigen Tycoon ausgeblutet wird. Die ortsansässigen Indianer zitieren den Sumpfgeist herbei, um den weißen Ausbeuter aufzuhalten. Bis zum Ende sterben ein paar Menschen, wobei der gute Morastbeschützer zwischen gutmütigen Photographen, aufdringlichen Umweltschützern und gewissenlosen Kriminellen keinen Unterschied macht. Dabei dürfen die Tyrannen gnadenlos rassistisch und opportunistisch sein, während die Indianer natürlich immer total mythisch rüberkommen. Selbst wenn sie nur einen Kaffee bestellen.
Die Figur des „Man-Thing“ hat es nie leicht gehabt. In den 1970ern im Hause Marvel ersonnen, wird sie bis zum heutigen Tage als arme Epigone von Detective Comics (kurz DC) durchaus erfolgreicherem Sumpfmonster „Swamp Thing“ verunglimpft. Dabei hatten Gerry Conway (Marvel) und Len Wein (DC), denen zum Teil die Erschaffung der Moos-Männer nachgesagt wird, in den frühen Siebzigern eine gemeinsame Wohnung. Wer nun vom wem abgeschrieben hat, ist eigentlich nebensächlich. Swampy durfte sich schon in den 80ern von keinem geringeren als Wes Craven (!) in seinem ersten Kinoausflug mächtig blamieren, Manny hingegen musste bis zum Jahr 2005 warten. Nur um nicht minder auf die Schnauze zu fallen.
Ein großes Manko an Leonards Interpretation der Saga ist, dass seine Verfilmung mit der eigentlichen Comicfigur abseits des Namens rein gar nichts gemein hat. Ist der Morast-Mann auf dem Papier der Biochemiker Ted Sallis, der durch ein missglücktes Experiment (was sonst?) zum Monstrum wird, macht man im Film daraus einen handelsüblichen apersonalen Indianer-Naturschutzgeist. Hätte man wenigstens das putzige Design (große Kulleraugen!) und die Superkräfte der Comicvorgabe beibehalten. Dort hat der transformierte Ted nämlich die Gabe, jeden, der Furcht vor ihm verspürt, durch seine Berührung in Flammen aufgehen zu lassen. Bescheuert, natürlich, aber nicht unoriginell.
Davon ist in der Zelluloidvariante nichts mehr vorhanden. Dafür darf sich „Man-Thing“ fürchterlichen CGI-Tentakeln erfreuen, mit denen er in bester „Alien“-Manier Leute aufspießen kann. Und das nicht einmal unblutig. Überhaupt erinnert der Film mehr an einen klassischen Creature-Horrorfilm als an eine typische Comicverfilmung. Es gibt durchaus gorige Szenen, und der Anfang des Films (zwei kopulierende Twens werden in bester Slasher-Tradition hingerichet) suggeriert fälschlicherweise ein anderes Genre. Dass es hier etwas wüster zugehen darf als bei den schon zu Massenidolen avancierten Genregrößen, liegt sicherlich auch daran, dass der Film vom berüchtigten Lions Gate-Studio produziert wurde, das mit dem dritten „Punisher“-Abenteuer sogar noch mehr Splatter in die Welt der Comicverfilmungen einbrachte.
Zwischen all dem Moos, Blut und unwirklichen Kunstnebel muss im Drehbuch natürlich auch noch Platz für eine Romanze gefunden werden, die vom jungen Sheriff und der Grundschullehrerin Rachael (Teri Elizabeth Richards) ausgefochten wird. Diese wirkt aber nicht nur akut unglaubwürdig, sondern bleibt für die Handlung auch absolut irrelevant. Die anderen menschlichen Charaktere im Film sind natürlich ebenso austauschbare Schablonenkreationen nach Schema F, die genauso hohl bleiben dürfen wie der Riese aus dem Moorland.
Wertung: 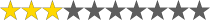 (3 / 10)
(3 / 10)
