 Um es gleich vorwegzunehmen, „Ken Park“ in Deutschland auf großer Leinwand bestaunen zu können bildet ein Privileg, welches sowohl dem Herstellungsland Amerika wie gleichermaßen auch England bislang verwehrt blieb. Ein Umstand, der bei einem Blick auf Regisseur Larry Clark nicht weiter verwundert, gelangte doch auch „Bully“, der letzte Film des ehemaligen Photographen, über ein Stadium ausufernder Diskussionen nicht hinaus. Verwunderlich also, aus welchem Grunde gerade „Ken Park“ den Sprung in ausgesuchte deutsche Programmkinos vollziehen konnte. Immerhin geht der letzte hierzulande kinematographisch bedachte Streifen Larry Clarks auf das Jahr 1998 zurück. Damals scheiterte das empfehlenswerte, obgleich weniger verstörende Gangster-Drama „Another Day in Paradise“ am Unmut des heimischen Publikums, so dass sich einzig überzeugte Befürworter des Clark´schen Erstlings „Kids“ mit Interesse und Neugier die Räuberpistole um James Woods und Melanie Griffith zu Gemüte führten.
Um es gleich vorwegzunehmen, „Ken Park“ in Deutschland auf großer Leinwand bestaunen zu können bildet ein Privileg, welches sowohl dem Herstellungsland Amerika wie gleichermaßen auch England bislang verwehrt blieb. Ein Umstand, der bei einem Blick auf Regisseur Larry Clark nicht weiter verwundert, gelangte doch auch „Bully“, der letzte Film des ehemaligen Photographen, über ein Stadium ausufernder Diskussionen nicht hinaus. Verwunderlich also, aus welchem Grunde gerade „Ken Park“ den Sprung in ausgesuchte deutsche Programmkinos vollziehen konnte. Immerhin geht der letzte hierzulande kinematographisch bedachte Streifen Larry Clarks auf das Jahr 1998 zurück. Damals scheiterte das empfehlenswerte, obgleich weniger verstörende Gangster-Drama „Another Day in Paradise“ am Unmut des heimischen Publikums, so dass sich einzig überzeugte Befürworter des Clark´schen Erstlings „Kids“ mit Interesse und Neugier die Räuberpistole um James Woods und Melanie Griffith zu Gemüte führten.
So wandte sich der Regisseur anderen Themenbereichen zu und legte im Jahre 2000 mit „Teenage Caveman“ eine geradezu lächerliche Endzeitutopie vor, die im Gegensatz zu erwähntem Folgewerk „Bully“ aber in der Bundesrepublik zumindest auf Video und DVD Auswertung fand. Nun also „Ken Park“, eine weitere in unheilsverkündender Erwartung auf das gesellschaftliche Scheitern der Generation Y weissagende Zustandsbeschreibung, ohne Illusionen, ohne Schnörkel. Direkt auf den Punkt gebracht sollte man als Betrachter eines Larry Clark-Filmes stets auf die visuelle Konfrontation grausamster Abgründe der menschlichen Psyche vorbereitet sein. Rege Tabubrüche gehören in den Sphären des umstrittenen Mittfünfzigers ohnehin zum guten Ton. So reiht sich ein weiteres abgründiges Werk unter dem Verzicht auf inhaltliche Konventionen und stringenten Handlungsablauf der abschüssigen Tendenz des verstörenden Individualisten hinter der Kamera ein und präsentiert einen ambitionierten wie zweifelhaften Trip hinter die heuchlerische Fassade inniger Vorstadtidyllen.
Unbequem und um Doppelbödigkeit bemüht, reißen Larry Clark und sein Co-Regisseur und Kameramann Ed Lachman den Betrachter bereits in der Fahrrinne des Vorspannes in den tristen Abgrund ihres nihilistischen Mikrokosmos: Begleitet durch die stilsicheren Klänge von Bouncing Souls´ „Lamar Vannoy“ treibt es Ken Park (Adam Chubbuck) auf seinem Rollbrett in Richtung eines örtlichen Skateparks, wo er sich am Rande des Pooles niederlässt, mit einer digitalen Videokamera aus seinem Rucksack seinen Kopf ins Zentrum der Aufnahme richtet und sich inmitten von gleichgesinnten Jugendlichen mit einer Pistole den Schädel wegbläst. Willkommen in Visalia, einem kalifornischen Vorort, der mehr dem Vorhof zur Hölle als den gepflegten Ausläufern einer Großstadt gleicht. An diesem Ort bilden die Einnahme von Drogen, selbstgeißelnde Masturbation, Alkoholismus, ausserehelicher Sex mit Minderjährigen, inzestuöse Bestrebungen und Mord einen entlarvenden Rundumschlag der spießbürgerlichen Schattenwelt. Der Schoß der Familie präsentiert sich als Hort der Entfremdung, als Hochburg psychischer Ränkespielchen. Moral und Anstand sind hier ein Zeichen der Schwäche, überleben können einzig die stärkeren.
Auf dieser Grundlage meißeln Larry Clark, der sich auch für das fragmentarische Drehbuch verantwortlich zeigt, und Lachman ein gewollt hintergründiges, obgleich überwiegend oberflächliches und plakatives Bildnis zerrütteter Ideale ins Bewußtsein des Zuschauers. Die Fortführung der Grundidee des Debüts „Kids“ in Gestalt der Integration der kaum weniger verruchten wie verlogenen Welt der Erwachsenen erscheint durchaus wohlwollend und künstlerisch ansprechend. Jedoch taugt die aufgezeigte kopflastige Inhaltsleere als Symbolisierung der Zerrissenheit amerikanischer Vorstädte nur bedingt. Statt dessen zeigen sich die Initiatoren bemüht zu verstören, die Kamera an prägnanten Stellen nicht vom Geschehen abzuwenden. So erweisen sich in Großaufnahme abgelichtete Masturbationen und am pornographischen unmerklich vorbeischrammende Teenievögeleien als Höhenflüge einer krassen Woge aus provozierenden Bildern und kontroversen Inhalten.
Dass es Larry Clark im Handstreich gelingt, sein Publikum zu schockieren, ist hinlänglich bekannt und auch „Ken Park“ nimmt für die visuelle Zumutbarkeit eine eigene Grauzone für sich in Beschlag. Auf diesem Fundament bleibt der freizügige Umgang mit körperlichen Intimbereichen allerdings der größte Diskussionspunkt eines ansonsten wenig diskutablen Filmes. Denn „Ken Park“ ist überwiegend zwiespältiges Independentkino, ein gefühlskaltes Drama in atmosphärischen Bildern, ummantelt von unnahbaren, emotional abstoßenden Episoden. Die Befangenheit des mageren inhaltlichen Gerippes, aus ausgeweideten Momenten der Befremdlichkeit Tiefgang erzeugen zu wollen, schmückt lediglich die Substanzlosigkeit und den allgegenwärtig scheinenden Mangel an Aussagekraft aus. Die Gefühlskälte des Filmes überträgt sich dabei schlagartig auch auf den Betrachter, emotionslos werden die Schicksale der Protagonisten ohne Sympathiewerte oder Anteilnahme hingenommen.
Zwar wissen die überwiegend unbekannten Darsteller, darunter auch Amanda Plummer („Pulp Fiction“), zu überzeugen, doch gelingt es den Akteuren kaum, jenen Mantel seelenloser Apathie zu durchbohren. Mit legendären und stilbildenden Photobänden hat Larry Clark in der Vergangenheit wichtige Einflüsse in die Kunst der Moderne injiziert und sich gleichermaßen Lob und Verruf eingehandelt. Diesen kontroversen Status vermochte er zwar auch ins Filmgeschäft zu übernehmen, doch verpufften die angestrebten Impulse im Zuge inhaltsschwacher Sozialstudien oftmals bereits im Ansatz. Fest steht allerdings, dass Begeisterung und Abneigung im Falle „Ken Parks“ Hand in Hand auf schmalem Grat einhergehen. Ob es sich dabei allerdings um ein vielschichtiges Kunstwerk oder einfach lebensverneinende Übersteigerung handelt, wird einmal mehr das Publikum allein entscheiden. Selbstverständlich nur, sofern es die Zensurbehörden gestatten.
Wertung: 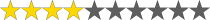 (4 / 10)
(4 / 10)
