
„This is a story of Heroic Deeds and the bitter struggle for the triumph of Good over Evil and of a wondrous Sword wielded by a mighty Hero when the Legions of Darkness stalk the land.“ – Kommt nicht zum Punkt: die einleitende Texttafel
In mittelalterlicher Vorzeit, die Religion des einen Gottes ist bereits etabliert, liegt ganz und gar irdische Magie in der Luft. Die äußert sich in einem ungesund grün leuchtenden Stein, der das Schwert eines weisen Alten (Ferdy Mayne, „Piraten“) in eine übermächtige Waffe verwandelt. An der (je nach Gesinnung) rechtschaffenden Macht des Stahls erfreuen kann er sich aber nicht mehr. Denn sein ältester Sohn Voltan (Quell des Overactings: Jack Palance, „Chatos Land“) ist den Verführungen der dunklen Seite erlegen und bringt den Erzeuger, weil der ihm das Geheimnis des Kampfwerkzeugs nicht offenbaren mag, kurzerhand um die Ecke. Wenn er es nicht haben kann, steht es auch keinem anderen zu. Klar.
Besser dran ist da schon Voltans Bruder Hawk (kam erst durch die Rolle des Christian Shephard im Serien-Klassiker „Lost“ zu später Popularität: John Terry), dem der sterbende Vater eigentlich noch so viel sagen möchte, ihn vor dem Exitus aber lieber geschwind in die Mysterien der magischen Klinge einführt. Aber kann die Strahlung des grünen Steins wirklich gesund sein? Hawks Schaden jedenfalls ist sie nicht, immerhin fliegt ihm die Klinge aus jedem Winkel zielsicher in die Faust; und so macht er sich raschen Fußes auf, den Bruder mit der entstellten Gesichtshälfte und dem albernem Darth-Vader-Gedächtnishelm für den Vatermord (und die Ausmerzung seiner Verlobten) zu richten. Was im Ansatz nach tragischen Ausmaßen der Marke Shakespeare klingt, ist in Wahrheit ein albernes wie gleichsam schwer angestaubtes Fantasy-Märchen mit steifen Mimen, gestelzten Dialogen und einer üppigen Portion unfreiwilliger Komik.
Die Frage nach dem Sieger im Kampf guter Bruder/böser Bruder stellt sich dabei natürlich nicht. Entscheidend ist der Weg zur bereinigenden, durch die Ambition einer angeflanschten TV-Serie nicht vollends entschiedenen Konfrontation. Auf dem durchstreift Hawk die mit Kunstnebelschwaden verhangenen Wälder, lehrt reihenweise Schurkenpack das Fürchten und verbündet sich mit illustren Gestalten. Solchen wie dem einhändigen Krieger Ranulf (William Morgan Sheppard, „Die Duellisten“), durch den Hawk einer von Voltan verschleppten Äbtissin (Annette Crosbie, „Ein Papst zum Küssen“) nachstellt. Als tatkräftige Unterstützer erweisen sich überdies der hünenhafte Hammerschwinger Gort (Bernard Bresslaw, „Krull“), der Elfen-Bogenschütze Crow (mit quakiger Originalstimme und sichtbar angeklebten Spitzohraufsätzen: Ray Charleson, „Gefangene des Universums“), der verschlagene Zwerg Baldin (Peter O’Farrell, „Legende“) sowie eine namenlose Zauberin (Patricia Quinn, „The Rocky Horror Picture Show“) mit magischen Neon-Ringen.
Regisseur und Co-Autor Terry Marcel, der auch den ersprießlich kruden „Gefangene des Universums“ (1983) kredenzte, beweist mit „Hawk – Hüter des magischen Schwertes“, dass Ideenlosigkeit und bereits zur Produktionszeit überholte Effekte keine Zeichen von Qualität sein können. Immerhin die nimmersatte Schund-Klientel hat einiges zu grienen, wenn der tapfere Titelheld zumeist dreinblickt, als wisse er selbst nicht so genau, wie er in dies halbgare Fantasy-Potpourri geraten ist. Sein Übriges zum Trash-Appeal steuert auch der grässliche Soundtrack von Harry Robertson („Taxi!“) bei, der zwischen 70’s-Rock, 80’s-Synthie und klassischer Folklore die Gehörgänge strapaziert. Gemeinsam mit Marcel verfasste Robertson auch das Skript und fungierte gleichsam als Produzent. Bei solch geballtem Einsatz kann eigentlich nichts schiefgehen. Außer dem kompletten Film.
Die konstant auf TV-Niveau rangierende Inszenierung kann den Mangel an Budget kaum verbergen. Das zeigt sich insbesondere an den spartanischen Waldkulissen, die optisch weniger hermachen als eine von Kindern mit Stöcken errichtete Forstbude. Noch „besser“ wird es bei den verblüffend verlustreichen Scharmützeln, wenn Armbrust und Elfenbogen auf Dauerfeuer geschaltet und die gegnerischen Reihen per repetitivem Stopptrick gelichtet werden. Nicht weniger glorreich: Die (erzählerische) Verwandtschaft des damals bereits 60-jährigen Palance und dem zur Produktionszeit gerade einmal halb so alten Terry. Naja, Anthony Quinn ist mit 81 Lenzen auch noch einmal Vater geworden. Dass Marcel & Co. die seriale Fortführung verwehrt blieb, ist beileibe kein Verlust. Den finalen Akt, bei dem auch diverse Helden ihr Leben lassen müssen, gestaltet das allerdings nur umso unvollendeter. Aber auch das passt zu diesem hoffnungslos überalterten, immerhin aber drollig beknacktem Film.
Wertung: 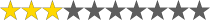 (3 / 10)
(3 / 10)
