 Michael Crichton erlangte nicht nur als Autor („Jurassic Park“) Weltruhm, sondern auch als Regisseur („Der große Eisenbahnraub“). Mit der Zeit wurden viele seiner Bücher verfilmt, nach dem grandiosen Erfolg von Steven Spielbergs Dinosaurier-Utopie „Jurassic Park“ (1993) auch „Congo“. Im Grunde ist der Roman ein gediegener Langweiler, weshalb John Patrick Shanley („Joe gegen den Vulkan“) bei der Ausarbeitung seines Skripts auch rigide Änderungen vornahm. Umgesetzt wurde das Projekt durch den berufenen Regisseur Frank Marshall („Arachnophobia“), für dessen Film „Überleben“ (1993) Shanley ebenfalls das Drehbuch verfasst hatte. So wurde aus der soliden Vorlage ein actionbetontes Trivial-Abenteuer, das sich bewusst den Klischees des Mainstream unterwirft.
Michael Crichton erlangte nicht nur als Autor („Jurassic Park“) Weltruhm, sondern auch als Regisseur („Der große Eisenbahnraub“). Mit der Zeit wurden viele seiner Bücher verfilmt, nach dem grandiosen Erfolg von Steven Spielbergs Dinosaurier-Utopie „Jurassic Park“ (1993) auch „Congo“. Im Grunde ist der Roman ein gediegener Langweiler, weshalb John Patrick Shanley („Joe gegen den Vulkan“) bei der Ausarbeitung seines Skripts auch rigide Änderungen vornahm. Umgesetzt wurde das Projekt durch den berufenen Regisseur Frank Marshall („Arachnophobia“), für dessen Film „Überleben“ (1993) Shanley ebenfalls das Drehbuch verfasst hatte. So wurde aus der soliden Vorlage ein actionbetontes Trivial-Abenteuer, das sich bewusst den Klischees des Mainstream unterwirft.
Bei einer Expedition im afrikanischen Dschungel wird Charles Travis (Bruce Campbell, „Tanz der Teufel“) in der mystischen Ruinenstadt Zinj getötet. Seine Verlobte Karen Ross (Laura Linney, „Kinsey“) bricht zu einer Ersatzexpedition auf, die vordergründig jedoch die für geplante Kommunikationstechnologien relevanten Funde der ersten Mission sichern soll. Zufälligerweise hat der zwielichtige Osteuropäer Homolka (Tim Curry, „Stephen King´s Es“), der in Zinj die Reichtümer König Salomons vermutet, das gleiche Ziel. Unter dem honoren Vorwand, die intelligente und via Computer kommunikationsfähige Affendame Amy in der Zielregion auswildern zu wollen, finanziert er dem Primatenforscher Peter Elliot (Dylan Walsh, „Blood Work“) die Heimführung seines Schützlings. Denn Amy hat in der Gefangenschaft Bilder gemalt, die eindeutig auf den Schatz verweisen.
„Congo“ verstrickt sich bis zur Ankunft in der Ruinenstadt in Belanglosigkeiten. Der Zwischenstopp im zerrütteten Einzugsgebiet des Militaristen Wanta (Delroy Lindo, „Domino“) wird durch überflüssige Actioneinlagen überschattet. Weitere Verstrickungen, beispielsweise die hanebüchene Attacke einer Gruppe Flusspferde, wirken nicht minder konstruiert. In Zinj angekommen, offenbart eine Horde abgerichteter Gorillas die Effizienz antiker Sicherheitssysteme und bringt den inhaltlich wenig geschlossenen Streifen zumindest im Schlussdrittel auf Kurs kurzweiliger Actionkost. Die verschenkten Darstellerleistungen, allen voran der haltlos überagierende Tim Curry, werden damit aber kaum aufgewogen.
Die damalige Tricktechnik ermöglichte die Animation der kriegerischen Primaten nicht in gewünschtem Umfang, so dass kostümierte Schauspieler zum Einsatz kommen mussten. Unter diesen tummelt sich auch Garde-Primat Peter Elliott („Gorillas im Nebel“), dessen Einfluss sich allein in der ehrerbietenden Namensgebung des Affenforschers im Film ermessen lässt. Frank Marshalls löchriges Abenteuer kann da kaum mithalten und bietet neben finalem Einsatz von Laser und Lava wenig erinnerungswürdiges. „Congo“ ist ähnlich steril wie das ohne Insekten dargestellte Afrika, ein hochglänzendes Konstrukt aus Hollywoods Baukasten für anspruchsloses Unterhaltungskino.
Wertung: 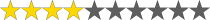 (4 / 10)
(4 / 10)
