 „Fuck magic!“ – Ward
„Fuck magic!“ – Ward
Der Weihnachts-Blockbuster war bislang der großen Leinwand vorbehalten. Peter Jacksons „Herr der Ringe“-Trilogie hat es zur Tradition erhoben, die Massen kurz vor den Feiertagen mit effektreichen Großproduktionen ins Kino zu locken. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Der Siegeszug von Streaming-Portalen wie Netflix übt jedoch starken Einfluss auf die gegenwärtigen Sehgewohnheiten aus. Die Bedeutung des Fernsehens schwindet und auch die Lichtspielhäuser bekommen den wachsenden Geltungsbereich des immer und überall verfügbaren Unterhaltungsangebotes zu spüren – nicht zuletzt, da der oben genannte Branchen-Primus neben Serien vermehrt auf die Eigenproduktion stargespickter Filme setzt. Der Veröffentlichungstermin des von Netflix exklusiv angebotenen Fantasy-Thrillers „Bright“ fiel in diesem Zusammenhang nicht von ungefähr auf zwei Tage vor Heiligabend.
Zwar geht dem von David Ayer inszenierten Genre-Mix die Familientauglichkeit der meisten fürs Kino gefertigten Festtags-Spektakel ab, die Signalwirkung ist trotzdem beträchtlich. Ganz aufgehen will der Plan allerdings nicht. Denn wie schon Ayers streitbare Comic-Verfilmung „Suicide Squad“ (2016) krankt auch der eigensinnige Cop-Film an der Unausgegorenheit des Drehbuchs, hier verfasst von Max Landis („Dirk Gentlys holistische Detektei“). Dabei erscheint dessen Ausgangslage durchaus originell: eine moderne Welt, in der Menschen, Orks und Elfen seit 2.000 Jahren mehr oder minder friedlich miteinander koexistieren. Das damit verbundene Gesellschaftsbild wird zu den Anfangstiteln über Graffitis veranschaulicht. Als Handlungsort dient Los Angeles, ein gern bemühter Schmelztiegel gesellschaftlicher Zerrissenheit. Doch gerade der tiefere Blick für die extravagante kulturelle Vielfalt geht der Story nahezu vollständig ab.
So wirkt es fast schematisch, wenn die Elfen die abgeschottete geistige und finanzielle Elite stellen, während die Orks mit fleckig dunkler Lederhaut und Wildschweinhauern ein Proletariat mit besonderer Abneigungstendenz bilden. Dazwischen steht die fast unscheinbar wirkende Menschheit. Die mit diesem ungleichen Gefüge verbundenen historischen und politischen Fragen, die selbst in vager Andeutung hätten viel zu Wirkung und Nachvollziehbarkeit beitragen können, bleiben ausgespart. Der Rest der Welt, ja selbst das übrige Nordamerika, spielt keine Rolle. Da ist lediglich L.A., eine isolierte urbane Insel als repräsentativer Setzkasten dieses selten zu Ende gedachten Ausgangsszenarios. In dem verrichtet Polizist Daryl Ward (spielte unter Ayer auch in „Suicide Squad“: Will Smith) mit Partner Nick Jacoby (Joel Edgerton, „Black Mass“) Dienst. Die Besonderheit daran: Nick ist ein Ork, mehr noch der erste seiner Art in Uniform.
Entsprechend groß ist das öffentliche Interesse. Nur bedeutet das nicht automatisch positive Resonanzen: Rassistische Kollegen setzen Nick zu, interne Ermittler wollen ihn wegen des Verdachts der Korrumpierbarkeit aus dem Amt werfen und seit er im Dienst angeschossen wurde, hegt auch Daryl Vorbehalte. All das rückt in den Hintergrund, als das Duo während eines Einsatzes auf die junge Elfin Tikka (Lucy Fry, „11.22.63“) stößt – und einen verbotenen, einzig von Magiekundigen gefahrlos zu berührenden Zauberstab, mit dessen Hilfe abtrünnige Elfen um Leilah (Noomi Rapace, „Prometheus“) einen dunklen Anführer ins Leben zurückholen wollen. Mit dem Entschluss, das Artefakt vor korrupten Ordnungshütern, kriminellen Banden und den mörderischen Elfen zu schützen, geraten die grundverschiedenen Cops in eine nächtliche Odyssee aus Flucht und Gewalt. Beistand verheißt einzig das Eingreifen der Bundesbehörde „Magic Task Force“ (u. a. Edgar Ramírez, „Gold“).
Es sind die Details, die „Bright“ zumindest partiell sehenswert gestalten: Feen als Fall für den Kammerjäger, Death-Metal als Liebesmusik der Orks oder ein Zentaur als Teil der berittenen Polizei. Gerade davon hätte es mehr gebraucht. Stattdessen tischt Ayer einen simplen Mix aus seinem eigenen „End of Watch“ (2010) und dem ähnlich gestrickten, wenngleich deutlich geschickter mit Vorurteilen und Buddy-Motiven jonglierenden „Alien Nation“ (1988) auf. Die Erzählung wirkt ungeachtet der bemüht lässigen, oft jedoch hölzern wirkenden Dialoge verblüffend ernst. Auch die Inszenierung setzt weniger auf hochglänzenden Hollywood-Bombast als vielmehr eine direkte, bevorzugt dreckige Bildsprache. Dazu passt die zynische Härte der dosierten Actionszenen. Überzeugend gerät das Gesamtwerk dennoch nur momentweise, weil der trotz Fantasy-Prämisse gewöhnliche Plot schwer in Gang kommt und nie den Verdacht entkräften kann, dass sich in diesem halbgaren Ideenpotpourri ein viel besserer Film versteckt. Immerhin musste für diese Erkenntnis kein Kinoticket gelöst werden.
Wertung: 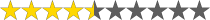 (4,5 / 10)
(4,5 / 10)
