 „Animals are beasts, but men are monsters.“ – Wally, außen Killer, innen Philosoph
„Animals are beasts, but men are monsters.“ – Wally, außen Killer, innen Philosoph
Jean Giraud, bekannter unter seinen Pseudonymen Gir und Moebius, ist einer der bedeutendsten Künstler der franko-belgischen Comicschule. Sein Blueberry, der bald schon seit 50 Jahren Generationen von Lesern begeistert, darf ruhigen Gewissens als einer der besten Arbeiten auf dem Gebiet des Western-Comics bezeichnet werden. Der niederländische Regisseur Jan Kounen, der dem Genrefan mit seinem wilden (wie überschätzten) „Dobermann“ in Erinnerung haften blieb, nahm mit der Verfilmung des Stoffes eine große Bürde auf sich auf – und scheiterte in jeder Hinsicht.
Die Geschichte ist schnell erzählt: Mike Blueberry (Hugh O’Connor, „Botched“) kommt als junger Bub in den Südwesten der USA, verguckt sich in ein junges Freudenmädchen, legt sich mit Nebenbuhler Wally (spielt in wirklich jedem Scheiß mit: Michael Madsen) an und lernt, wie böse die Menschen doch sein können. Das Mädchen ist daraufhin tot und der schwer verwundete Mike irrt im Delirium durch die Gegend. Sioux-Indianer finden ihn und flicken ihn wieder zusammen, was er echt dufte findet, so dass er lange nach seiner Genesung noch bei ihnen bleibt.
Irgendwann – sichtlich gealtert, da er jetzt von Vincent Cassel (in Kounens „Dobermann“ der titelgebende und hundsgemeine Protagonist) verkörpert wird – ist er in der kleinen Stadt Palomito als Marshall im Namen des Gesetzes tätig. Im Innern hat er aber immer noch mit seinen Dämonen zu kämpfen. Erst in einem durch schwerste Drogen eingeläuteten Showdown auf metaphysicher Ebene (!) mit seiner Nemesis Wally kann er die Vergangenheit bewältigen und Erlösung finden. Und der gemarterte Zuschauer ebenso.
„Loosely adapted from the ´Blueberry´ comic series by Moebius“ heißt es noch im Vorspann. Nicht eine halbe Stunde später dürfte sich jeder, der auch nur mal einen Band der Reihe durchgeblättert hat, fragen, ob die Macher des Films dies auch mal getan haben. Es hätte ihnen bestimmt nicht geschadet, denn neben dem Titel gibt es so gut wie gar nichts, was daraus zu stammen scheint. Niente. Nada. Dabei darf sich Girauds Comic in der an Sensationen nicht geizenden europäischen Comicwelt einer Top-Platzierung in der Liste der gelungensten Dauer-Serien erfreuen.
Was die unglaublich gut geschrieben Stories noch exklusiver macht, ist die Tatsache, dass der Protagonist Mike Blueberry altert! In den ersten Abenteuern aus den 1960ern ist er noch ein frischer junger Mann voller Tatendrang, um ihn dann bis zur Jahrtausendwende zum deutlich gealterten, grauhaarigen Haudegen heranreifen zu lassen. In Kounens Edel-Langweiler bekommen wir anfangs auch einen jungen Mike zu sehen, allerdings dient dieser Teil seiner Vita nur dazu, seine inneren Dämonen entstehen zu lassen, damit er diese später mit reichlich Peyote und anderen bewusstseinserweiternden Substanzen wieder los werden kann.
Und damit wären wir schon beim größten Problem des Films: Da er langsam aber sicher seinen Ursprung vergisst und immer mehr zum psychedelischen Selbstfindungstrip ausufert, wird mit jeder weiteren Minute ersichtlich, was für eine Mist Kounen da verzapft hat. Der gezeichnete Blueberry ist ein waschechter Western, der auf Zelluloid gebannte ein waschechter Carlos Castaneda (Unwissenden hilft Wikipedia weiter). Kounen, der sich als großer Bekenner des Schamanismus, Aminismus und der nord- und mesoamerikanischen Ureinwohnermythologie outet, wollte mit seinem Werk einen nie dagewesen Indianerfilm erschaffen. So edel sich das auch anhören mag, so unverständlich bleibt, warum er dafür ausgerechnet die Marke „Blueberry“ missbrauchen musste.
Für jeden Fan des Serials ist Kounens LSD-Flick ein Schlag ins Gesicht. So richtig feste und mitten in die Fresse rein. Zumal der Acid-Trip, der mit Einsatz von zweitklassigen Effekten die durch Rauschgift entstandenen Visionen visuell erfahrbar macht, schlicht und ergreifend katastrophal geriet. Digitale, sich windende Schlangen und alle möglichen Insekten so weit das Auge reicht, lassen uns letzen Endes verblüfft mit der Frage zurück, was das ganze eigentlich soll. Kounen griff für seine Vision (hah!) auf einen namhaften internationalen Cast zurück, der in Nebenrollen Prominenz wie Juliette Lewis, Tcheky Karyo, Djimon Hounsou, Colm Meaney und Ernest Borgnine auffährt. Auch hat er wirklich atemberaubende Bilder von der Landschaft Mexikos und Spaniens einfangen können. Jedoch geht alle augenscheinliche Qualität dank grottiger Tricks in einem 124 Minuten langen pseudo-metaphysischen Nonsens zugrunde. Wer diese zwei Stunden tatsächlich durchhält, dem kann auch ein „Bloodrayne 2 – Deliverance“ kaum mehr schaden.
Wertung: 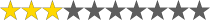 (3 / 10)
(3 / 10)
