 Der Berufskeiler als Gutmensch: Steven Seagal („Hardt o Kill“) hatte sich die Bewahrung von Mutter Natur schon auf die Fahne geschrieben, als Oscar-Preisträger Al Gore („Eine unbequeme Wahrheit“) noch mit der Rolle des Vizepräsidenten haderte. Die Weltenrettung mit Handschlag, praktiziert im fadenscheinigen, die schneebedeckten Weiten Alaskas zum Austragungsort erklärenden Öko-Actioner „Auf brennendem Eis“, ist zugleich sein Debüt als Regisseur. Dabei sollte es vorläufig bleiben, hatte der Maestro in der Folge doch alle Hände voll zu tun, die im Abstieg begriffene Karriere über Wasser zu halten.
Der Berufskeiler als Gutmensch: Steven Seagal („Hardt o Kill“) hatte sich die Bewahrung von Mutter Natur schon auf die Fahne geschrieben, als Oscar-Preisträger Al Gore („Eine unbequeme Wahrheit“) noch mit der Rolle des Vizepräsidenten haderte. Die Weltenrettung mit Handschlag, praktiziert im fadenscheinigen, die schneebedeckten Weiten Alaskas zum Austragungsort erklärenden Öko-Actioner „Auf brennendem Eis“, ist zugleich sein Debüt als Regisseur. Dabei sollte es vorläufig bleiben, hatte der Maestro in der Folge doch alle Hände voll zu tun, die im Abstieg begriffene Karriere über Wasser zu halten.
Verschwörungstheoretiker mögen behaupten, Seagal wurde Hollywood aufgrund seines offen dargelegten Aktionismus zu heikel. Der Wahrheit näher kommt wohl eher die Tatsache, dass diese zum Teil hochnotpeinliche Posse das trashigste Vehikel des gescheiterten Genrestars stellt. Das wiederum bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass der versiert gezimmerte Streifen keinen Spaß bereiten würde. Im Gegenteil. Das Vergnügen an der knorrigen Nachhaltigkeit offenbart sich früh und geradezu exemplarisch, wenn Seagal als Brandbekämpfer Forrest Taft, reaktionäre Arbeiter in einer Kaschemme vermöbelt. Wie es so seine Art ist, begegnet der kampfeslustige Bilderbuchrecke der Demütigung – schließlich wird er von den Schuften als „Zuckerpüppi“ ausgewiesen – mit Faustschlägen.
Die unfreiwillige Komik resultiert aber nicht aus dem beißenden Kontrast der Friedensbringung durch Gewalteinsatz, sondern der wiederholt aufgelegten Predigermentalität. Nachdem die Fresse des Oberrüpels blutig geprügelt ist, setzt Seagal ein Gesicht pastoraler Gleichmut auf. Das Betroffenheitsbarometer steigt, wenn er zur anschließenden Frage ausholt: „Was ist nötig? Was ist noch nötig um einen Mann von Grund auf zu ändern?“ Dem Schenkelklopfer folgt die Läuterung. Und weil sich die Praktizierung der Gemütsveränderung seiner Mitmenschen durch Hiebe auf die Omme bewährt, macht Taft gleich bei seinem durchtriebenem Boss Jennings (da helfen auch keine drei Oscars: Michael Caine, „Gottes Werk und Teufels Beitrag“) und dessen rechter Hand MacGruder („Scrubs“-Star John C. McGinley) weiter.
Die nämlich nutzen ihre Position als Betreiber einer Ölbohrunternehmung schamlos aus, indem schadhafte Dichtungen verbaut und mutwillig die Umwelt verpestet wird. Gottlob kommt ihm der heldenhafte Feuerwehrmann auf die Schliche, was wiederum eine Riege bezahlter Killer auf den Plan ruft, die dem zwischenzeitlich durch eine Explosion in die mythische Welt der Inuit eingetauchten Apostel des Umweltschutzes zuleibe rücken sollen. Zwar sind diese und andere Nebenrollen mit solchen Gesichtern wie R. Lee Ermey („Full Metal Jacket“), Billy Bob Thornton („One False Move“) und Joan Chen („Der letzte Kaiser“) prominent besetzt, der mangelnden Glaubwürdigkeit des Streifens wird damit aber keine Abfuhr erteilt.
Selbstzweckhafter der Pferdeschwanz nie wedelte: Der gestelzte Monolog am Ende, der noch einmal mit (vielen) Worten zusammenfasst, was zuvor mit grober Kelle vermittelt wurde, ist der Tief- und gleichermaßen Schlusspunkt eines Filmes, dessen konträre Einzelteile in der Summe nie zusammenfinden. Gerettet wird der teils urkomische Partyböller durch gut inszenierte, mit brachialer Härte geschmückte Actionexzesse. Da werden Leiber von Splitterminen zerfetzt, blutig zu Klump geballert oder in den Heckrotor eines Helikopters gestoßen. Die Intention rechtfertigt den beschaulichen Härtegrad. Doch selbst der kann den gnädigsten Action-Freund nicht vom höhnischen Blick auf die viel zu dick aufgetragene Moralsauce ablenken. Ein selten dämliches Werk mit reichlich (unfreiwilligem) Spaßpotenzial.
Wertung: 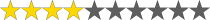 (4 / 10)
(4 / 10)
