 „Das Schicksal von Alamo ist das Schicksal von Texas.“
„Das Schicksal von Alamo ist das Schicksal von Texas.“
Ruhmreiche Episoden nationalhistorischer Bedeutsamkeit haben im amerikanischen Kino eine lange Tradition. Die hart erkämpfte Unabhängigkeit des 28. Bundesstaates Texas Mitte des 19. Jahrhunderts, bzw. der vorangegangene Fall des militärischen Stützpunktes Alamo bleibt auf filmischem Sektor unmittelbar mit dem Namen John Wayne verbunden. Denn der ‚Duke’ – der sich 1968 mit dem propagandistisch-reaktionären Kriegsstreifen „The Green Berets“ endgültig als politischer Rechtsaußen postulierte – opferte 1960 einen gehörigen Part seiner Energie wie gleichwohl seines privaten Vermögens zugunsten der Realisierung des von ihm selbst inszenierten Films „The Alamo“.
Und da solcherlei Hohelieder auf Tapferkeit und Kampfeswillen über die Jahrhunderte kaum Rost ansetzen, beschloss Disney-Tochter Touchstone im vergangenen Jahr ihr eigenes Süppchen aus dem geschichtsträchtigen Kapitel zu kochen. Das Projekt lockte große Namen an, Oscarpreisträger Ron Howard („A Beautiful Mind“) sollte Regie führen, während mit Russell Crowe („Gladiator“) ein weiterer „Würdenträger“ für eine der tragenden Rollen vorgesehen war. Doch wie so häufig erwiesen sich auch in diesem Falle die verschiedenen Budgetvorstellungen der Parteien als unüberwindbare Kluft. So distanzierte sich neben Howard alsbald auch Crowe von „The Alamo“.
Letzten Endes übertrug man die Bürde dem wenig erfahrenen Regisseur John Lee Hancock („Die Entscheidung“), welcher in den 90ern unter anderem die Drehbücher zu den Clint Eastwood-Filmen „A Perfect World“ und „Mitternacht im Garten von Gut und Böse“ verfasst hatte. Mit einem abgespeckten Finanzrahmen von 95 Millionen Dollar und wohlklingenden Namen wie Dennis Quaid („Traffic“) und Oscarpreisträger Billy Bob Thornton („The Man Who Wasn´t There“) in der Besetzungsliste beging Hancock „The Alamo“ – und erlebte sein eigenes künstlerisches Waterloo.
Denn die spröde Lektion in amerikanischer Historie, die weniger als ein Fünftel ihrer Kosten an den Kinokassen einspielte, entpuppt sich als glanzlose Aufarbeitung eines bewährten ideologischen US-Krückstocks. Pathetisch bis zur Hutkrempe läutet Hancock seinen Film mit einem kurzen Rückblick auf die Geschichte des ursprünglich als Mission erbauten Postens Alamo ein. Im Laufe der Jahrzehnte – so lehren uns die introduktierenden Zwischenblenden – wurde das befestigte Areal zur Festung umfunktioniert. Nicht nur gegen nahende Armeen, sondern auch „gegen plündernde Indianer“ sollten die Mauern Schutz bieten. Und wo wir uns den Genozid an Amerikas Ureinwohnern gerade schöngeredet haben, können wir ja unvermittelt in den auf Authentizität bedachten Handlungsrahmen einsteigen.
Das Schicksal von „The Alamo“ ist hinreichend bekannt: Im Jahr 1836 marschiert die mexikanische Armee unter der Führung des Generals Santa Ana (Emilio Echevarría, „Amores Perros“) in Texas ein. Indem der junge Colonel William Travis (Patrick Wilson, „Angels in America“) das strategisch wichtige Fort Alamo verteidigt, hofft General Sam Houston (Quaid) genug Zeit zu gewinnen, um eine schlagkräftige Armee zur Bezwingung Santa Anas formieren zu können. Unter den Männern befinden sich auch der legendäre Davy Crockett (Thornton) und James Bowie (Jason Patric, „Narc“). Als Alamo von der Mexikanischen Armee eingekesselt wird, entbrennt für die Eingeschlossenen ein 13-tägiger Todeskampf.
Weder opulent noch epochal, vermag „The Alamo“ einzig im Bereich der aufwändigen Ausstattung zu überzeugen. John Lee Hancocks Inszenierung, welche in ihrer elegischen Bildführung und der weitgehend unspektakulären Umsetzung manch stilistische Note von Ron Howard adaptiert, erscheint fad und altbacken. Zwar gelingt es dem vornehmlich für das Fernsehen tätigen Regisseur über weite Strecken plumpen Patriotismus auszusparen, doch gerät das glorifizierte finale Scharmützel zur revisionistischen Bewährungsprobe. Denn anstatt „The Alamo“ mit dem Sieg der mexikanischen Invasoren über die zahlenmäßig hoffnungslos unterlegenen Amerikaner ausklingen zu lassen, muss noch schnell Houstons Bezwingung des despotischen Santa Ana beigefügt werden. In diesem Sinne hätte wohl auch erst das Aufzeigen der atomaren Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki Michael Bays „Pearl Harbor“ komplettiert.
Auch darstellerisch bleibt „The Alamo“ eher karg. Billy Bob Thornton bleibt als fiedelnder Fährtensucher weit hinter seinen Fähigkeiten zurück, Jason Patric gibt farblos den siechenden Lagerkommandanten und mehr als grimmige Mundwinkelakrobatik ist bei Dennis Quaid auch nicht zu holen. Neben der belanglosen musikalischen Begleitung des Coen´schen Hauskomponisten Carter Burwell („The Big Lebowski“, „Being John Malkovich“) strapaziert vor allem gähnende Langeweile das Nervenkostüm des Zuschauers. Im Aufkommen des Angriffs auf Fort Alamo hat der Film zwar manch starke Szene, doch vermag John Lee Hancock im Vorfeld nur unzureichend die desperate Situation unter den Eingeschlossenen einzufangen. Somit bleibt „The Alamo“ brotlose Kunst, ein langatmiges Historienepos um aufopfernden Heldenmut, welches auf dem heimischen Bildschirm weit besser aufgehoben ist, als auf großer Leinwand.
Wertung: 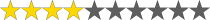 (4 / 10)
(4 / 10)
