 Bereits die erste Szene von „Shut In“, eine Kamerafahrt über die bewaldeten Weiten Maines, erhebt die Isolation zur Essenz. Dieser prophetische Inszenierungskniff ist seit Stanley Kubricks „The Shining“ (1980) ein gern genutztes Stilmittel; ein wenig inflationär zwar, der atmosphärischen Grundierung aber zweifelsfrei dienlich. Nur ist das mit dem Stimmungsbild so eine Sache in Farren Blackburns („Marvel’s Daredevil“) schalem Mystery-Thriller. Denn der verhaltene narrative Aufbau und ein durchaus solider Mittelteil stehen in keinem ausgewogenen Verhältnis zum überzogen auf Konfrontation pochenden Schlussdrittel.
Bereits die erste Szene von „Shut In“, eine Kamerafahrt über die bewaldeten Weiten Maines, erhebt die Isolation zur Essenz. Dieser prophetische Inszenierungskniff ist seit Stanley Kubricks „The Shining“ (1980) ein gern genutztes Stilmittel; ein wenig inflationär zwar, der atmosphärischen Grundierung aber zweifelsfrei dienlich. Nur ist das mit dem Stimmungsbild so eine Sache in Farren Blackburns („Marvel’s Daredevil“) schalem Mystery-Thriller. Denn der verhaltene narrative Aufbau und ein durchaus solider Mittelteil stehen in keinem ausgewogenen Verhältnis zum überzogen auf Konfrontation pochenden Schlussdrittel.
Im idyllischen Nirgendwo bewohnt Kinderpsychologin Mary Portman (Naomi Watts, „King Kong“) ein großes Haus. Neben ihr ist da noch Stiefsohn Stephen (Charlie Heaton, „Stranger Things“), der nach einem verheerenden Autounfall, bei dem der Vater zu Tode kam, zum apathischen Pflegefall wurde. Während die zurückgezogene Mary mit dem Entschluss ringt, Stephen dauerhaft in ein Hospiz zu geben, nimmt sie den verhaltensauffälligen schwerhörigen Tom (Jacob Trembley, „Raum“) bei sich auf. Doch kurz nach seiner Ankunft verschwindet der Neunjährige spurlos. Als Mary darauf von alptraumhaften Visionen geplagt wirkt, beginnen die Grenzen zwischen Wahn und Wirklichkeit allmählich zu verschwimmen.
Bedauerlicherweise wird aus dieser sattsam bekannten Basis keine echte Spannung destilliert. Möchte man die entschleunigte Einleitung noch als Zeichen deuten, gängige Klischees des Genres zu unterlaufen, verliert der Film mit den Ausprägungen von Marys Realitätsverlust den roten Faden. Oliver Platt („The Big C“) stellt als Therapeut Dr. Wilson via Skype Ferndiagnosen, dient aber letztlich nur der zufälligen Entdeckung des wahren Gefahrenherds. Wenn Mary nicht gerade die Tötung Stephens halluziniert oder von kleinen Händen in der Dunkelheit drangsaliert wird, knüpft sie zarte Bande zum Vater eines Patienten. Nur mutet diese Episode an wie schnödes Zeitschinden. Dabei wirkt „Shut In“ zerfahren, wie eine lose Sammlung von Ideen aus deutlich besseren Geschichten.
Hauptdarstellerin Naomi Watts liefert eine souveräne Darstellung ab und auch die Bilder von Kamerafrau Yves Bélanger („Dallas Buyers Club“) überzeugen. Damit hat es sich dann aber auch. Lange steuert der Film auf eine Auflösung zu, die im Kopf des Betrachters als einzige plausible Erklärung infrage kommt. Die tatsächliche Wendung wird in ihrer Absurdität lediglich von der Streckung des Finales übertroffen, das als Katz-und-Maus-Spiel klassische Register des Psycho-Thrillers zieht, artverwandten Vorgängern wie „Schatten der Wahrheit“ (2000) aber nie das Wasser reichen kann. So bleibt ein unbefriedigender Genre-Beitrag mit Lücken und Längen. Schade ist es letztlich allein um die Watts.
Wertung: 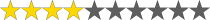 (4 / 10)
(4 / 10)
