 Filme der Mockbuster-Schmiede The Asylum zeichnen sich durch Bescheidenheit aus. Egal ob Effekte oder Talent vor wie hinter der Kamera, alles bleibt höchst bescheiden. Aber der Erfolg gibt der US-Produktionsfirma recht, die immerhin für ihre Vermarktungsstrategie (Billigkopien namhafter Großproduktionen überschwemmen kurz vor deren Kinostart die Videotheken) und die Neugier weckenden Covergestaltungen gelobt werden müssen. Wenn aber nicht gerade der plumpe Nachbau von Blockbuster-Ideen auf dem Plan steht, wird nicht selten die alte Mär vom mordenden Tierreich bemüht.
Filme der Mockbuster-Schmiede The Asylum zeichnen sich durch Bescheidenheit aus. Egal ob Effekte oder Talent vor wie hinter der Kamera, alles bleibt höchst bescheiden. Aber der Erfolg gibt der US-Produktionsfirma recht, die immerhin für ihre Vermarktungsstrategie (Billigkopien namhafter Großproduktionen überschwemmen kurz vor deren Kinostart die Videotheken) und die Neugier weckenden Covergestaltungen gelobt werden müssen. Wenn aber nicht gerade der plumpe Nachbau von Blockbuster-Ideen auf dem Plan steht, wird nicht selten die alte Mär vom mordenden Tierreich bemüht.
So auch in „Shark Week“, der im Titel schamlose Nähe zur populären Doku-Reihe des Discovery Channel sucht. Zwar geht es im Film von Christopher Douglas Olen Ray („2-Headed Shark Attack“) auch um die Gefährlichkeit der seit Spielbergs „Weißem Hai“ stigmatisiertem Meeresräuber, der Rahmen ist aber gewohntermaßen ungemein trashig – und verknüpft lose Handlungsmuster von „Saw II“ und „Shark Night“. Denn in Kalifornien werden acht einander unbekannte und scheinbar in keinerlei Verbindung stehende Menschen (u.a. Polizist, TV-Journalistin, Leibwächter, Richterin) entführt und auf eine Insel in internationalen Gewässern gebracht.
Dort sinnt Drogenbaron Tiburon (Patrick Bergin, „Der Feind in meinem Bett“) mit Gehilfin Elena (Yancy Butler, „Lake Placid 3 + 4“) auf Rache für den Tod seines Sohnes. Die Entführten haben alle ihren Anteil daran. Doch statt sie einfach zu töten, zwingt er sie zu einem pervertierten Spiel, bei dem sie von einer Seite der mit Kameras gespickten Insel zur anderen gelangen und sich dabei jeden Tag einer anderen Hai-Spezies stellen müssen. Das ist so bekloppt, wie es sich anhört, verströmt aber bereits durch die maßlos überzogenen (und anhaltenden Vollsuff vermuten lassende) Darbietungen von Bergin und Butler, die wahrlich maßlos um die Wette chargieren, einen gewissen Unterhaltungswert.
Ein gefundenes Fressen ist der sichtlich schmal budgetierte Streifen – man beachte allein die unglaublich miese und schreiend blöde Durchquerung des Minenfelds am Strand – also nicht nur für die schlicht animierten Killerfische, sondern auch nimmersatte Freunde beschränkter Unterhaltung. Billig ist dabei einmal mehr das Wort der Stunde (genauer eineinhalb Stunden) und trifft neben Machart, Schauspielern und Tricks auch auf die immens miesen Schnitt- und Kameramätzchen zu. Wer Schwachsinn sucht, wird auf dieser Insel der Einfalt ganz sicher fündig. Und zumindest ein bisschen Spaß macht das Ganze auch noch. Allein das ist fast mehr, als man von den meisten Asylum-Produktionen erwarten darf.
Wertung: 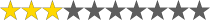 (3 / 10)
(3 / 10)
