 Die „Resident Evil“-Reihe knüpft mit jedem Teil unmittelbar an den jeweiligen Vorgänger an. Am Ende von „Extinction“ kündigte die genetisch veränderte Heroine Alice (immer noch stoisch bis zur Schmerzgrenze: Ex-Model Milla Jovovich) samt einer Schar Klonkriegerinnen die Zerstörung der Tokio-Zweigstelle des abgrundtief bösen und für die Zombie-Apokalypse verantwortlichen Umbrella-Konzernes an. Gleich zum Auftakt des mit „Afterlife“ überschriebenen vierten Parts verleiht sie ihrer Drohung Ausdruck. Dabei wird schnell deutlich, dass sich der auf den Regiestuhl zurückgekehrte Paul W. S. Anderson mit Vorliebe der Superzeitlupen-Ästhetik der „Matrix“-Trilogie bedient.
Die „Resident Evil“-Reihe knüpft mit jedem Teil unmittelbar an den jeweiligen Vorgänger an. Am Ende von „Extinction“ kündigte die genetisch veränderte Heroine Alice (immer noch stoisch bis zur Schmerzgrenze: Ex-Model Milla Jovovich) samt einer Schar Klonkriegerinnen die Zerstörung der Tokio-Zweigstelle des abgrundtief bösen und für die Zombie-Apokalypse verantwortlichen Umbrella-Konzernes an. Gleich zum Auftakt des mit „Afterlife“ überschriebenen vierten Parts verleiht sie ihrer Drohung Ausdruck. Dabei wird schnell deutlich, dass sich der auf den Regiestuhl zurückgekehrte Paul W. S. Anderson mit Vorliebe der Superzeitlupen-Ästhetik der „Matrix“-Trilogie bedient.
Der optische Aufwand, veredelt durch zeitgemäße, mit dem für James Camerons „Avatar“ entwickelten Fusion Camera System gefilmte 3D-Effekte bewahrt den stumpfen Endzeit-Horror-Actioner aber nicht vor dem Absturz in die Belanglosigkeit. Denn Anderson, der bereits die originäre Verfilmung der populären Videospiel-Saga besorgte, kaut ohne Inspiration offene Handlungsfetzen des letzten Films durch und erweckt heuer den Eindruck eines flüchtig eingeschobenen Zwischenkapitels. Solches Kalkül scheint beim Produzentengespann um Bernd Eichinger („Zeiten ändern dich“) allerdings schon seit Beginn der Kinoreihe fest zum Konzept zu gehören.
So pulverisiert Alice mit mehr unfreiwillig komischen als coolen Einzeilern die unterirdische Umbrella-Zentrale und gewährt Konzernscherge Wesker (Shawn Roberts, „Diary of the Dead“) die Einführung als Feindbild im Stile eines Endgegners aus dem Konsolen-Game. Er raubt Alice durch eine Injektion die durch das T-Virus ausgelösten Superkräfte, was sie jedoch nicht davon abhält, den folgenden Flugzeugcrash unbeschadet zu überstehen. Sie macht sich auf die Suche nach den in „Extinction“ eingeführten Überlebenden. Nur wurden die mit Ausnahme von Claire Redfield (Ali Larter, „Heroes“) von Umbrella eingefangen.
In einem Hochhaus treffen die beiden auf weitere Verbündete und Claires verschollenen Bruder Chris („Prison Break“-Star Wentworth Miller). Die bis dahin fahrlässig vergessenen Zombie-Horden sorgen im Mittelteil für optische und inszenatorische Höhepunkte. In furiosen Zeitlupen-Sequenzen wird der Überlebenskampf zum durchgestylten Spektakel hochstilisiert. Stärker als zuvor wird, wie allein der hünenhafte Henker zeigt, die Grundlage der Spiele zitiert. Fans des Konsolen-Horrors wird das milde stimmen. Nur verfällt „Resident Evil: Afterlife“ in der Konfrontation Weskers und der Befreiung des entführten Menschheitsrestes wieder in den einfallslosen wie akut ironiefreien Trott der trashigen Einleitung. Die Schauwerte werden durch die einfältige Dramaturgie und von Klischees überwucherten Figuren damit nachhaltig entkräftet. Vor einer weiteren Fortsetzung dürfte das trotzdem nicht schützen.
Wertung: 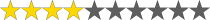 (4 / 10)
(4 / 10)
