 Zwei Wölfe, so will es die indianische Sage, kämpfen in der Brust eines jeden Mannes um die Vorherrschaft. Der eine ist Liebe, der andere Hass. Eine andere Sage, die des deutschen Filmemachers Marcus Nispel, will dem Publikum vorgaukeln, dass die Wikinger, historisch verbürgt schon Jahrhunderte vor Kolumbus auf amerikanischem Boden zugegen, die neue Welt für sich beanspruchen wollten. Woran die Unternehmung scheiterte? Etwas, vielmehr jemand hielt die Nordmänner auf.
Zwei Wölfe, so will es die indianische Sage, kämpfen in der Brust eines jeden Mannes um die Vorherrschaft. Der eine ist Liebe, der andere Hass. Eine andere Sage, die des deutschen Filmemachers Marcus Nispel, will dem Publikum vorgaukeln, dass die Wikinger, historisch verbürgt schon Jahrhunderte vor Kolumbus auf amerikanischem Boden zugegen, die neue Welt für sich beanspruchen wollten. Woran die Unternehmung scheiterte? Etwas, vielmehr jemand hielt die Nordmänner auf.
„Pathfinder“, mit viel Fantasie an das gleichnamige norwegische Abenteuer-Drama von 1987 angelehnt, ist die Spekulation hinter der geschichtlichen Fußnote. Nispel, als Regisseur von Musikvideos bekannt geworden, gab sein Kinodebüt mit dem Remake des „Texas Chainsaw Massacre“. Seine stilistischen Wurzeln verleugnete er damit nicht. Im Gegenteil. Die visuelle Komponente überzeugte. Nur blieb keine Handlung, mit der er sich als Geschichtenerzähler hätte empfehlen können. Das Problem seines Zweitwerks bleibt dasselbe.
Die Handlung ist banal. Sie hätte für ein ansehnliches B-Movie getaugt. Doch Nispel will mehr. Er strebt ein Epos an. Nur verweigert sich dieses im Sturm der Klischees jeglicher Kunstfertigkeit, die über die dominante Form hinausreichen würde. Das schafft Längen, die wiederum durch archaisches Schlachtengetümmel versucht werden zu überbrücken. Die Spielart moderner Inszenierung steht im Kontrast zum Kontext. Schnelle Schnitte und verzerrte Kamerabewegungen sind das Gegenstück zu den schneebedeckten Wäldern der unwirtlichen Handlungsorte. Die Optik ist bestechend, weil der Regisseur neben atmosphärischer Farbreduziertheit einfallsreiche Kameraperspektiven findet. Ihre Wirkung aber verblasst in der stilisierten Unübersichtlichkeit der barschen Scharmützel.
Der Expansion der wütenden Wikinger stehen die Ureinwohner im Wege. Also sollen sie vernichtet werden. Die Kriegskunst der Indianer hat den schweren Rüstungen und scharfen Schwertern der Eindringlinge nichts entgegenzusetzen. Mit Ausnahme von Ghost, einst in der Fremde zurückgelassener und vom Naturvolk aufgezogener Spross der Seefahrer. Verkörpert wird er von Karl Urban, der schon in „Doom“ mit Bravour seine mangelnden Qualitäten als tragender Akteur unter Beweis stellte. Dessen ungeachtet ist es an ihm, Nordmann Gunnar (Clancy Brown, „Starship Troopers“) und seine Getreuen (darunter TV-„Conan“ Ralf Möller) vom Genozid abzuhalten. Denn er kennt die Kriegsart seines alten Volkes und ist überdies listig genug, dem zahlenmäßig überlegenen Feind die Stirn zu bieten.
Natürlich ringen die beiden Wölfe auch in Ghosts Brust. Damit der Wolf der Liebe nicht am Hungertuch nagt, ist da Moon Bloodgood („Antarctica“), die Tochter des alternden Fährtensuchers Russell Means („Der letzte Mohikaner“). Doch immer wenn Zwischenmenschlichkeiten aufkeimen, bricht der Wolf des Hasses durch. Denn Nispel weiß die Geschichte weder packend zu erzählen, noch gelingt es ihm die emotionalen Aspekte in gebotener Weise herauszuarbeiten. Worauf er sich versteht ist zünftiger Aderlass. Der allein reicht aber kaum aus um die behäbig erzählte Schlachtplatte auf achtbares Mittelmaß zu hieven.
Wertung: 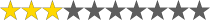 (3 / 10)
(3 / 10)
