 Donovan, Eric Roberts‘ alter Ego in „Dead or Alive“, ist ein Fiesling. Nicht einmal die erzwungenermaßen für ihn arbeitenden Fachkräfte vertrauen ihm. Exemplarisch äußert sich das über eine Tätowierung im Nackenbereich der Kämpferin Helena (Sarah Carter, „Final Destination 2“), eine fünfstellige Zahl, die der Schlüssel zu Donovans Vermögen ist. Das Hauptaugenmerk der Macher dieser mauen Prügelspielverspielung liegt offenkundig nicht auf einer schlüssigen Handlung. Trotzdem sorgt Regisseur Corey Yuen („The Transporter“) für nachhaltiges Kopfschütteln. In der ersten Hälfte aufgrund der überraschenden Kurzweil, in der zweiten durch den gescheiterten Versuch, doch noch eine Geschichte erzählen zu wollen.
Donovan, Eric Roberts‘ alter Ego in „Dead or Alive“, ist ein Fiesling. Nicht einmal die erzwungenermaßen für ihn arbeitenden Fachkräfte vertrauen ihm. Exemplarisch äußert sich das über eine Tätowierung im Nackenbereich der Kämpferin Helena (Sarah Carter, „Final Destination 2“), eine fünfstellige Zahl, die der Schlüssel zu Donovans Vermögen ist. Das Hauptaugenmerk der Macher dieser mauen Prügelspielverspielung liegt offenkundig nicht auf einer schlüssigen Handlung. Trotzdem sorgt Regisseur Corey Yuen („The Transporter“) für nachhaltiges Kopfschütteln. In der ersten Hälfte aufgrund der überraschenden Kurzweil, in der zweiten durch den gescheiterten Versuch, doch noch eine Geschichte erzählen zu wollen.
Kaum ein Film könnte so schlecht sein, als das der deutsche VIP Medienfonds 4 nicht noch finanzielle Beihilfe leisten könnte. Dazu der prominente Produzent Bernd Eichinger, der in Kooperation mit „Soldier“-Regisseur Paul W. S. Anderson bereits die „Resident Evil“-Filme auf die Leinwand gebracht hatte. Nun also erfährt „Dead or Alive“, eine der meistverkauften Computerspielreihen, den Sprung in die Realität. Der Vorgabe entsprechend unter konstanter Vernachlässigung von Figurenzeichnung und Logik. Die Quintessenz dieses ´Alles ist möglich´-Kosmos sind schlanke Frauenkörper. Die leicht beschürzten Damen treten Ärsche und sehen – nicht selten reduziert auf Großaufnahmen bestimmter Körperpartien – einfach gut aus. Das muss genügen, um die männliche Zielgruppe zufriedenzustellen.
Alljährlich versammelt Donovan die besten Fighter der Welt auf seinem privaten Eiland, um sie in einem Turnier aufeinandertreffen zu lassen. Nicht ohne Hintergedanken, plant er über den Teilnehmern injizierte Mikroroboter die perfekte Kampftechnik zu erringen. Dem Gegenüber stehen Killerin Christie (Holly Valance, „Prison Break“), Wrestlerin Tina (Jaime Pressly, „My Name is Earl“) und die japanische Prinzessin Kasumi (Devon Aoki, „Sin City“), die ihren ein Jahr zuvor an gleicher Stelle verschollenen Bruder zu finden hofft. Der Vorstellung der Protagonisten (u.a. Natassia Malthe, „Elektra“ / Kane Kosugi, „Muscle Heat“) folgt die Einladung zum Turnier. Eine Actionsequenz reiht sich an die nächste, ohne das hinderliche Dialoge oder Anflüge von zusammenhängender Handlung Längen implizieren könnten.
Die Künstlichkeit der Bilder liegt am Puls der Zeit. Dazu kommt die permanente Bewegung, die sich von den Protagonisten auf die Kamera überträgt. Die Kombination aus humoristischem Nonsens und fliegenden Fäusten erinnert nicht selten an die Kinoaufbereitung von „Drei Engel für Charlie“, verfügt aber nicht über dessen Charme. Zumal „Dead or Alive“ nur eine schöne Verpackung ohne jeden Inhalt ist. Weh tut der Film, der im Grunde nicht mehr sein will als anspruchsloses Kintopp, niemandem. Bis zu einem gewissen Grad funktioniert das. Zumindest so lange, bis wieder die pure Idiotie dazwischen funkt.
Wertung: 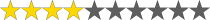 (4 / 10)
(4 / 10)
