 Zombies im Wilden Westen? So lange, wie das älteste Genre der Filmgeschichte schon totgesagt wird, liegt die Zusammenführung nahe. Neu ist die Idee jedoch nicht, wenn sie auch auf ein Segment minimalbudgetierter Horrorstreifen beschränkt bleibt, die sich einem breiten Publikumszirkel konsequent verschließen. Neben „The Quick and the Undead“ versucht sich auch „The Dead and the Damned“ an der Fusion aus Revolvermännern und Untoten. Gekostet hat der Film fast nichts. Das setzt Ambition voraus, die man Regisseur, Autor und Komponist Rene Perez („Alien Predator War“) auch unmöglich absprechen kann. Nur hat sein amateurhaftes Werk wenig zu bieten, was interessierte Zuschauer über die offenkundigen Mängel hinwegsehen lässt.
Zombies im Wilden Westen? So lange, wie das älteste Genre der Filmgeschichte schon totgesagt wird, liegt die Zusammenführung nahe. Neu ist die Idee jedoch nicht, wenn sie auch auf ein Segment minimalbudgetierter Horrorstreifen beschränkt bleibt, die sich einem breiten Publikumszirkel konsequent verschließen. Neben „The Quick and the Undead“ versucht sich auch „The Dead and the Damned“ an der Fusion aus Revolvermännern und Untoten. Gekostet hat der Film fast nichts. Das setzt Ambition voraus, die man Regisseur, Autor und Komponist Rene Perez („Alien Predator War“) auch unmöglich absprechen kann. Nur hat sein amateurhaftes Werk wenig zu bieten, was interessierte Zuschauer über die offenkundigen Mängel hinwegsehen lässt.
Der deutsche Verleih bediente sich zur Reichweitensteigerung eines seit den Sechzigern beliebten Tricks – und machte die Hauptfigur kurzerhand zu Django. Mit Bedienung der blutgierigen Wiedergänger wird daraus „Django vs. Zombies“ (ein UK-Alternativtitel ist „Cowboys & Zombies“) und durch Anflanschung des Gesichtes von Franco Nero, der jenen oft bedienten Django 1966 (und 1987) verkörperte, auf dem Cover wird die Illusion perfekt. Oder eben perfekt durchschaubar. Aber widmen wir uns dem Film selbst, der zum Auftakt eine Schießerei im Freizeit-Wildwest-Städtchen bietet, die an Perez‘ Inszenierungsqualitäten berechtigte Zweifel aufkommen lassen. Dabei vorgestellt wird Kopfgeldjäger Mortimer (David A. Lockhart), der sich ohne Zögern mit jedem steckbrieflich gesuchten Verbrecher anlegt, um ein möglichst großes Vermögen anzuhäufen.
Der Grund ist (natürlich) eine Frau, die aber ebenso wenig interessiert, wie die Hintergründe der übrigen Figuren. Selbstverständlich gilt es bei No Budget-Produktionen wie dieser Abstriche hinzunehmen. Denn natürlich sieht der Wilde Westen nach Sauerland und die Prärie-Kauze nach Bad Segeberg aus. Aber mangelnden Einsatz kann man den Pseudo-Schauspielern nicht zur Last legen. Höchstens geringe Ausdruckskraft. Doch zurück zum emsigen Mortimer, der sich auf die Spur des Indianers Brother Wolf (Rick Mora) begibt, der ein Mädchen vergewaltigt und brutal ermordet haben soll. Mit (unfreiwilliger) Unterstützung der von ihm aufgekauften Rhiannon (Camille Montgomery) lockt der Prämienjäger den Gesuchten aus seinem Versteck und nimmt ihn gefangen.
Dumm nur, dass ein paar Goldgräber der Region einen grün leuchtenden Meteoriten ausgebuddelt haben, der im nahen Städtchen alle Einwohner in Zombies verwandelt. So müssen Mortimer und der selbstredend unschuldige wie edle Wilde paktieren. Aber auch das ist mehr langweilig denn aufregend, weil Szenen kein Ende finden und mehr gesprochen als geschossen wird. Effekte und Masken sind gemessen an der Produktionsgüte gelungen, nur sehen manche Untote aus wie Zirkusclowns. Nachladebedarf meldet Mortimers Colt auch nur selten an, was sich als hilfreich erweist, als gegen Ende mit CGI-Hilfe Köpfe platzen. Aufregend ist das kaum und Spaß macht es auch nur, wenn (im englischen Original) der deutschsprechende Kopfgeldjäger-Kollege (Robert Amstler) auftaucht. Mehr als akute Armseligkeit ist da über weite Strecken nicht zu holen.
Wertung: 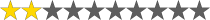 (2 / 10)
(2 / 10)
