 „In the end, all that matters is what you’ve done.”
„In the end, all that matters is what you’ve done.”
Er war der größte Feldherr der Antike, Stratege, Eroberer und Staatsmann zugleich. Er errichtete ein Weltreich von gigantischen Ausmaßen und verband auf dem Gipfel seiner Macht das Abend- mit dem Morgenland. Die Rede ist von Alexander dem Großen, einer der legendärsten und bedeutendsten Persönlichkeiten in der Historie des Menschen. Der dreifache Oscarpreisträger Oliver Stone ist abonniert auf geschichtsträchtige Stoffe, verfilmte er neben „Platoon“ und „Geboren am 4. Juli“ doch auch „J.F.K“ und „Nixon“. Bei seinem 150 Millionen Dollar teuren Traumprojekt „Alexander“ verlässt sich Stone allerdings zu sehr auf die Wucht und den Bombast seiner Inszenierung – und gibt sein Heldenepos so schon frühzeitig der Banalität preis.
Die Portraitierung des makedonischen Heerführers, gespielt von einem blondierten Colin Farrel („Der Einsatz“), gerät zu eindimensional. Akribisch, beinahe sklavisch folgt „Alexander“ den Mechanismen des klassischen Monumentalschinkens und kaut von „Ben Hur“ bis „Spartacus“ artig Sandalenrhetorik und ehrfürchtiges Pathos wider. Allein für die schleppende Einleitung – mit einem greisen Anthony Hopkins („Hannibal“) als narratives Bindeglied – opfert Stones Skript mehr als eine halbe Stunde. Und auch danach gewinnt das dreistündige Opus nur schleppend an Fahrt. Denn bei solider Inszenierung und großartiger Ausstattung ist „Alexander“ vor allem eins, nämlich lang – endlos lang. Auf der sandigen Strecke bleibt dabei in erster Linie das Interesse des Zuschauers.
Die wenigen Schlachtszenarien sind aufwendig gestaltet und gespickt mit adäquaten Härten, im Angesicht der fahlen Portraitierung des makedonischen Weltenbummlers allerdings nur temporärer Orientierungspunkt auf dem beschwerlichen Weg Richtung Abspann. Wenn sich die Kamera vom staubverhangenen Himmel rasant gen Schlachtfeld senkt, spritzendes Blut und schreiende Krieger einfängt, dann ist Stone in seinem Element. Weniger gelingt ihm das Geschichtenerzählen, denn mit viel Ehrgeiz und wenig Gefühl für das Wesentliche versucht der umstrittene Altmeister den historischen Komplex in sein Bild zu pressen. Blut und Schweiß bietet „Alexander“ in ausreichendem Maße, nur an Herz fehlt es dem Film an allen Ecken und Enden.
Colin Farrell mimt den bisexuellen Herrscher an der Oberfläche mit Inbrunst, doch in den entscheidenden Momenten wirkt sein Spiel ebenso blass wie die blondgelockte Mähne. Angelina Jolie („Taking Lives“) räkelt sich als Alexanders Mutter lasziv durch ihre Darbietung und bekommt zum besseren Verständnis der intriganten Gesinnung stets ein Rudel Schlangen in die unmittelbare Umgebung gekarrt. Der aufgedunsene Val Kilmer („The Doors“) kommt als Alexanders Vater noch am besten davon, wird dieser mit Plauze und verkrustetem Karl Dall-Auge doch zumindest wieselflink aus der Erzählung gemeuchelt. Rosario Dawson („25 Stunden“) begnügt sich in der Hauptsache mit blankem Körpereinsatz, während Jared Leto („Fight Club“) den heimlichen Geliebten des Herrschers mimt.
Den Kampf gegen das von Baz Luhrman angestrebte Alexander-Projekt konnte Oliver Stone zwar für sich entscheiden, der konsequenten Abneigung seitens Kritikern und Publikum hatte er jedoch wenig entgegenzusetzen. Die sechs Nominierungen für die Goldene Himbeere erscheinen der einhelligen Verunglimpfung zwar ein bisschen zu viel, doch war Oliver Stone bestimmt niemals glücklicher in dieser Hinsicht so konsequent übergangen worden zu sein. Wer dachte, mit Wolfgang Petersens „Troja“ sei der historischen Einfalt letzter Schlusspunkt bereits gesetzt, sieht sich getäuscht – und dank Oliver Stone und „Alexander“ nun sogar eines Besseren belehrt.
Wertung: 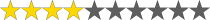 (4 / 10)
(4 / 10)
